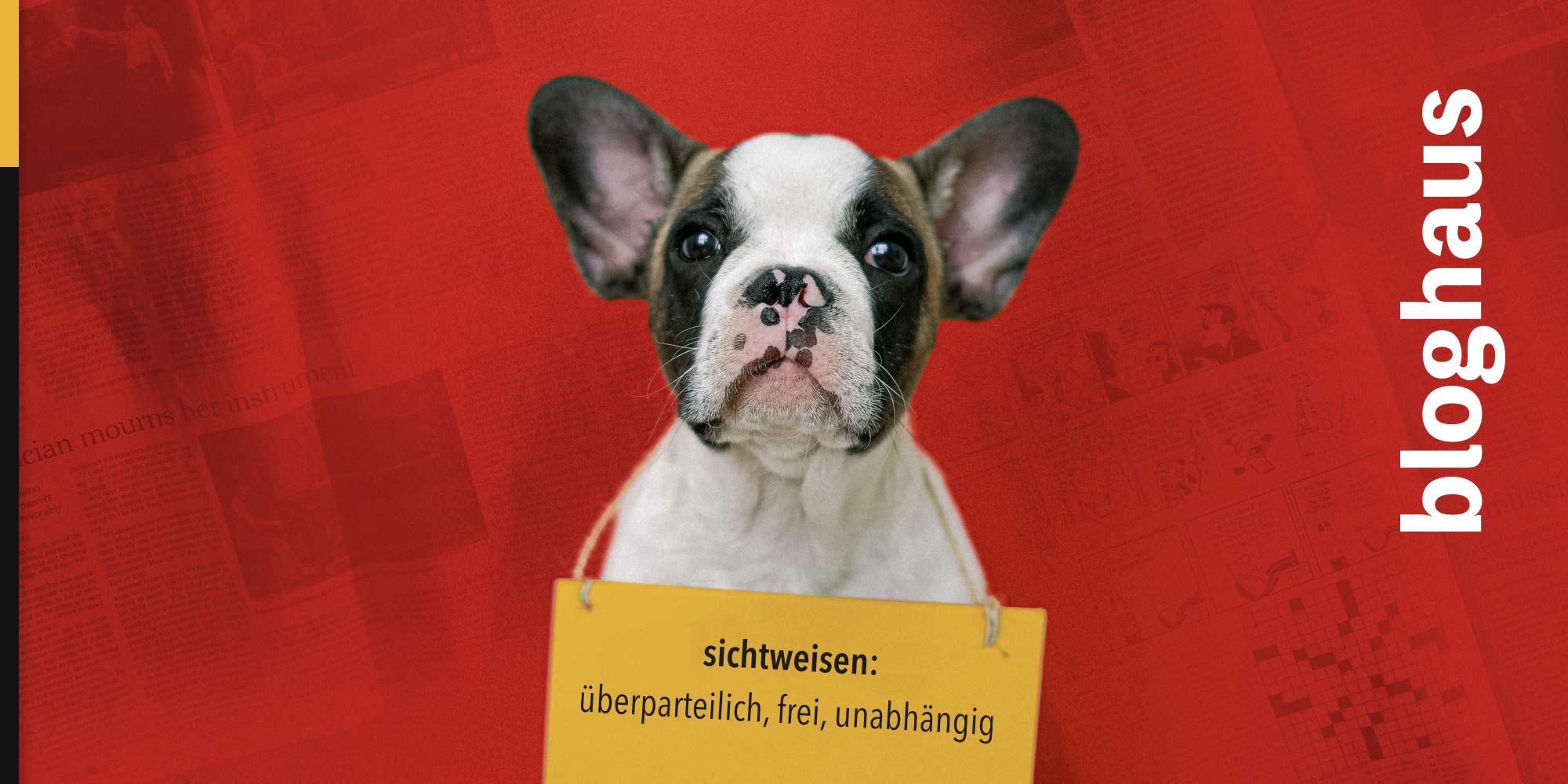– Das Erzbistum Köln muss nicht für die Straftat eines ihrer Priester haften –
Das Kölner Landgericht hat die Klage einer Frau auf Schmerzensgeld gegen das Kölner Erzbistum wegen sexuellen Missbrauchs abgelehnt (Az. 5 O 220/23). Es sieht keine „Amtshaftung“ des Erzbistums für die Missbrauchstaten eines seiner Angestellten: Ein Priester hatte in den 70er- und 80er-Jahren mehrfach Pflegekinder missbraucht und war wegen dieser Taten 2022 zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Nun fordert ein sechs Jahre lang missbrauchtes, geschwängertes und unwissentlich zur Abtreibung gezwungenes Opfer vom Erzbistum Köln Schmerzensgeld in Höhe von 830.000 Euro. Doch das Gericht befindet: Der Priester habe „mehr oder weniger als Privatperson“ gehandelt, das Erzbistum sei somit nicht in der Pflicht, Schadenersatz zu leisten und habe auch seine Aufsichtspflicht nicht verletzt. Ein Priester als Privatmann? Da scheint sich die Katholische Kirche zur Abwehr von Haftungsansprüchen in ihrem institutionellen und grundgesetzlich geschützten Selbstverständnis vergaloppiert zu haben. Mit im Sattel sitzt die Kölner Justiz, der eine Betroffeneninitiative mit Blick auf den nach ihren Erfahrungen bisher überaus zuvorkommenden Umgang mit Kardinal Rainer Maria Woelki „Voreingenommenheit für diese alte, ehrwürdige Institution“ vorwirft.
Das Urteil zeugt von völliger Unkenntnis davon, wie umfassend die Katholische Kirche das Priesteramt versteht, indem eben zwischen dienstlichem Tun und privater Lebensführung nicht unterschieden wird. Danach kann ein Priester durch die geforderte „Ganzhingabe“ niemals völlig zur Privatperson werden. Er unterschreibt keinen Arbeitsvertrag, er wird geweiht, er gibt sich und sein Leben für die Berufung zum Priester auf. Der Lebenswandel mit Ehelosigkeit, sexueller Enthaltsamkeit und Kleiderordnung ist vorgeschrieben Es wäre ein unbotmäßiger Eingriff ins Privatleben. Das aber haben Priester eben nicht mehr…
Missbrauchs- und Opferbeauftragte sind ob des Urteils zu Recht auf dem Baum: Wenn es Priestern und Kirchenleuten in den vergangenen Jahren gelang, sich qua Amt das Vertrauen von Menschen zu erwerben, verdanken sie das ihrem Beruf. Wenn sie das Vertrauen und die ihnen im Sorgeverhältnis anvertrauten Menschen missbrauchen – dann soll ,das Privatsache sein.
„Das Gericht hat allein auf der Grundlage des Gesetzes entschieden“, betonte eine Gerichtssprecherin, geradeso, als ob dies nicht die Regel sei. In der Rechtsprechung habe sich durchaus die Auffassung etabliert, dass die Kirche für Taten von Priestern in Mithaftung genommen werden könne, sagte sie. Das gelte allerdings nicht pauschal. Entscheidend sei, ob der Priester die Tat in Ausübung seines Amtes begangen habe. Nicht alles, was ein Priester tue, könne als Amtshandlung im juristischen Sinn gewertet werden. Die Frage, wie es in diesem konkreten Fall gewesen sei, habe das Gericht in dem Verfahren beantworten müssen – und am Ende entschieden, dass der erforderliche enge Zusammenhang mit der klerikalen Tätigkeit hier nicht gegeben gewesen sei. Die Katholische Kirche hatte argumentiert, dass dieses Sorgeverhältnis durch einen staatlichen Akt begründet worden sei, nicht durch einen kirchlichen. Doch hat der Staat nicht einem alleinstehenden Mann, sondern dem Priester das Sorgerecht für die damals Zwölfjährige übertragen, weil er eben Priester und nicht Privatmann war.
Wo bleibt die Empathie mit den Opfern?
Der Kölner Staatsrechtler Stephan Rixen kritisierte im Gespräch mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (F.A.Z.) die Urteilsbegründung scharf. Die Unterscheidung zwischen dem Amtsträger, der in seiner Freizeit Privatmensch außer Dienst ist, passe zu normalen Staatsbeamten, so der Hochschullehrer. Zu katholischen Priestern passe dies nicht, wie sich anhand des theologischen Selbstverständnisses der katholischen Kirche und auch nach ihrem Recht leicht erschließen lasse. Der frühere Kölner Erzbischof Joachim Kardinal Meisner habe Weihekandidaten einmal ins Stammbuch geschrieben, Priester könne es „nie rein privat geben“. Sie seien „entprivatisiert im Raum der Kirche“, davon gebe es „keine Beurlaubung“. Im vorliegenden Fall komme hinzu, so Rixen, dass der Kölner Erzbischof Joseph Kardinal Höffner die Pflichten des Klerikers, der die Minderjährige als Pflegekind aufnehmen wollte, so konkretisiert habe, dass er das Mädchen gerade als Kleriker, auch religiös, betreuen sollte. Auch darin, so Rixen, komme das kirchliche Amtsverständnis zur Geltung, denn der Bischof definiert den konkreten Aufgabenkreis des Klerikers.
Das Landgericht meine hingegen, es müsse zur Klärung der Frage, was ein kirchliches „Amt“ ist, sich nicht mit dem kirchlichen Selbstverständnis auseinandersetzen. Nach Rixens Worten widerspricht dieses Vorgehen den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur Pflicht staatlicher Gerichte, das kirchliche Selbstverständnis zu berücksichtigen – und das Erzbistum Köln wehre sich dagegen nicht, „weil die Missachtung des kirchlichen Selbstverständnisses prozesstaktisch vorteilhaft ist, denn die Ignoranz gegenüber dem eigenen Priesterbild, das sonst hochgehalten wird, zahlt sich im Wortsinn aus, weil der Klägerin kein Schmerzensgeld gezahlt werden muss“.
Rixen fragt sich, warum das Landgericht Auslegungen favorisiere, die dem beklagten Erzbistum Köln zum Vorteil gereichen, obwohl sich andere, betroffenenfreundliche Auslegungen aufdrängten. Allgemein folgt für Rixen daraus: „Aus Sicht der Betroffenen sexualisierter Gewalt ist es generell wünschenswert, dass die Gerichte bei solchen Amtshaftungsprozessen ihre üblichen, für staatliche Beamte geltenden Begründungsansätze differenziert weiterentwickeln, also mit Sinn für die Eigenheiten des kirchlichen Bereichs.“ So ließe sich auch der für viele Betroffene schwer zu ertragende Eindruck vermeiden, die Empathie der Justiz mit der „Täterorganisation Erzbistum Köln“, wie der Kölner Weihbischof Rolf Steinhäuser einmal formuliert habe, sei größer als die Empathie mit den Opfern.
Ungeachtet des überaus ernsten Themas zum Abschluss eine kaberettreife Überlegung von Stephan Hermsen, Redakteur Kultur und Reportage bei der „Neue Ruhr / Rhein Zeitung“ : „Wenn sich nunmehr Kardinal Woelki der verqueren Logik des Landgerichtsurteils annimmt, müsste er eigentlich seine Entscheidung von Juli 2023 zurücknehmen: Der Papst hatte damals, auf seinen Antrag hin, den Missbrauchstäter U. aus dem Klerikerstand entfernt. Wenn U. die ganzen Taten jedoch als Privatperson begangen hat – bekommt er dann jetzt seine Priesterwürde zurück? Nur zum Dienstgebrauch, versteht sich.
Lesen Sie auch unseren kirchenkritischen Beitrag: „Vergelt´s Gott! Die Kirche kostet ein Vermögen“