Wenn Wissenschaft autoritär wird
„Folgt den Wissenschaften!“ lautet der Ruf, mit dem Greta Thunberg und die von ihr mitinitiierte Bewegung „Fridays for Future“ vor einigen Jahren die Öffentlichkeit aufgerüttelt haben. Die Fakten zur Klimaveränderung lägen auf dem Tisch. An ihnen ließe sich nicht rütteln. Es sei an der Politik, schlicht die Konsequenzen aus den Fakten zu ziehen, sie nicht zu zerreden und auf Zeit zu spielen. Möglicherweise seien angesichts der Klimakrise harte und unangenehme Entscheidungen zu treffen sind. Schließlich: Anders als mit politischen Gegnern, Geschäftspartnern oder Gewerkschaften, mit denen Konflikte mit Kompromissen aus dem Weg zu räumen seien, könne man mit der Physik nicht verhandeln. Dazu komme, so die Klima-Aktivisten, der Zeitfaktor. Für langwierige Verhandlungen fehle angesichts der fortgeschrittenen Erderwärmung schlicht die Zeit. Es müsse etwas geschehen, wenn man die Menschheitskatastrophe noch abwenden wolle, orientiert an den Fakten der Klimaforschung, radikal und jetzt.
Demokratische Entscheidungsprozesse jedoch brauchen Zeit und der Kompromiss ist gewissermaßen das Lebenselixier der Demokratie. Das provoziert Fragen: Kommt dieses Modell in der Klimakrise an seine Grenzen? Und: Muss Politik sich künftig der Wissenschaft unterordnen?
Auch in der Corona-Pandemie hatte man ja vielfach den Eindruck, die Entscheidungsarena werde weniger von Politikern als von Virologen beherrscht. Das Virus war eine unsichtbare Gefahr, in seiner Natur und seinen Risiken nur von Spezialisten einzuschätzen. Der Politik blieb dann oft nur, den Empfehlungen der Wissenschaftler zu folgen, auch wenn die bei genauer Betrachtung ja gar nicht mit einer Stimme sprachen, sondern durchaus sehr unterschiedliche Auffassungen zu den Gefahren des Virus und den probaten Maßnahme zu seiner Eindämmung äußerten. Kritik an den Maßnahmen richtete sich jedoch meist an die Politik. Sie hätte noch stärker auf die Wissenschaft hören und ihr bedenkenträgerisches Kleinklein noch konsequenter zurückstellen sollen.
Zum Sinnbild dieser Haltung wurde paradoxerweise ein Mann, der selbst ein Politiker war, aber eben auch Medizinprofessor und scheinbar mit allen Studien zum Virus und der Pandemie bestens aus erster Hand vertraut – Karl Lauterbach (SPD). In einem Buch, das er nicht allzu lang nach Übernahme des Amtes des Bundesgesundheitsministers veröffentlichte, macht auch er sich stark für eine Führungsrolle der Wissenschaft. Angesichts von Klimakrise, Pandemien, ökologischen Herausforderungen und steigender Komplexität sozialer und technischer Zusammenhänge könne die Politik tragfähige Problemlösungen nur noch schaffen, wenn sie sich an den Befunden und Schlussfolgerungen der Wissenschaft orientiere.
Literaturwissenschaftler Peter Strohschneider, als Vorsitzender des Wissenschaftsrats, der Zukunftskommission Landwirtschaft und als ehemaliger Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft selbst überaus profilierter Wissenschaftspolitiker, tritt dieser These allerdings entschieden entgegen. In seinem Buch „Wahrheiten und Mehrheiten. Kritik des autoritären Szientismus“ zeigt er, dass die These „Folgt der Wissenschaft“ nicht nur eine anti-demokratische Haltung ausdrückt, sondern das Eigentümliche von neuzeitlicher Wissenschaft und der Politik in der modernen Gesellschaft verfehle. Wissenschaft und Politik haben sich als spezialisierte Funktionssysteme der modernen Gesellschaft herausgebildet, so Strohschneider – Wissenschaft als System zur Generierung von Wahrheiten, Politik als System der Herbeiführung kollektiv bindender Entscheidungen. Beide haben ihre eigene Logik, ihre eigene Sprache, ihre eigenen Regeln und nur weil sie sich daran orientieren, können sie ihre gesellschaftliche Funktion erfüllen und ihre jeweilige Leistung entfalten. Politik gründet nicht auf Wahrheitsansprüchen, sondern auf der Artikulation von Interessen und deren Ausgleich. Wissenschaft gründet nicht auf Macht und Kompromiss, braucht sich um Mehrheiten also nicht zu kümmern. Genau diese Differenzierung von Handlungssphären setzt in der Moderne Produktivkräfte und Problemlösungskapazitäten in vorher nicht gekanntem Ausmaß frei, verlangt den Menschen aber auch ab, mit dieser Differenzierung, Perspektivenvielfalt und Uneindeutigkeit zu leben. Das fällt nicht immer leicht, die Sehnsucht nach ganzheitlichen Problemlösungen aus einem Guss, nach Eindeutigkeit und klaren Ansagen ist groß.
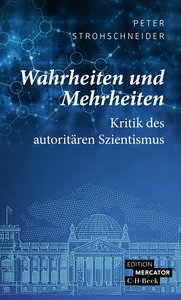
Wahrheiten und Mehrheiten –
Kritik des autoritären Szientismus
Peter Strohschneider,
C. H. Beck, München 2024,
16 Euro
ISBN 978 3 406 81568 3
Strohschneider zeigt aber zugleich sehr überzeugend, dass es etwas gibt, das Politik und Wissenschaft verbindet. Er nennt es das Prinzip der „Vorbehaltlichkeit“. Mit dem Übergang zur modernen Gesellschaft ist die Wissenschaft zu einem offenen Prozess in der Zeit geworden, in dem immer wieder neue Erkenntnisse entstehen, die bestehende Erkenntnisse widerlegen oder zumindest doch relativieren. Was die Wissenschaft feststellt, sind keine ewigen Wahrheiten, sondern temporäre Erkenntnisse unter dem Vorbehalt späterer Korrektur. Und genau so ist Politik, zumindest demokratische Politik, ein nie abzuschließender Prozess des Ringens um gute Problemlösungen, um Kompromisse und Entscheidungen, die aber nie für alle Zeiten gelten, sondern bis auf Weiteres, bis sich neue Konstellationen von Interessen und Kräften ergeben, neue Prioritäten gesetzt werden und neue Mehrheiten finden.
All dies wird von der aktivistischen Wissenschaft negiert. Sie möchte in die Gesellschaft hineinwirken, nimmt für ihre Position aber nicht nur das in Anspruch, was allen Bürgern zusteht, nämlich eine bestimmte Meinung in einem Vielklang der Stimmen zu artikulieren, sondern verkündet eine, wie es Strohschneider nennt, „vorpolitische Wahrheit“, die dem Deutungspluralismus ebenso entzogen ist, wie dem politischen Ringen um den richtigen Weg. Darin liegt das autoritäre Element dieses Selbstverständnisses von politisch engagierter Wissenschaft.
Strohschneider zeigt an den Ausführungen Karl Lauterbachs ebenso wie an einem „offenen Brief“ von in der „Scientists Rebellion“ zusammengeschlossenen Wissenschaftlern zur Räumung des Dorfes Lützerath im rheinischen Braunkohlenrevier im Januar 2023, wie Wissenschaft zur autoritären „Pose“ wird, die sich eine Kompetenz anmaßt, die sie in einer demokratischen Gesellschaft nicht hat und nicht haben sollte.
Allerdings wäre mit Strohschneider auch die Politik missverstanden, wenn man sie auf bloße Perspektivenvielfalt, Dauerdiskussion und Dauerreflexion reduzieren würde. Der politische Prozess ist wertlos, wenn er nicht zu Entscheidungen führt, die für die Gesellschaft bindend sind, selbstverständlich immer auf Zeit und unter dem Vorbehalt neuer Bewertungen und Mehrheiten. Robert Habeck, der sich, ebenfalls in einem Politikerbuch, für ein Verständnis von Politik als Dauerreflexion ausspricht und damit gewissermaßen den Gegenakzent zu Lauterbach setzt, hat nach Strohschneider damit das Wesen der Politik und das, was von ihr in der Gesellschaft zu Recht erwarten wird, missverstanden.
Autoritärer Szientismus nutzte den Klimawandel ebenso wie Pandemien und gesellschaftliche Krisen dazu, die Wissenschaft zu dem Souverän zu machen, der nach dem berühmten Diktum von Carl Schmitt über den Ausnahmezustand entscheidet. Das mühsame Ringen um Mehrheiten und Kompromisse wird dann schnell als der Dringlichkeit der Sache unangemessen und letzten Endes schädlich diskreditiert. Auch so komme Demokratie in Gefahr.
Vielleicht ist aber, so könnte man denken, die Demokratie den gegenwärtigen Problemen und Herausforderungen gar nicht gewachsen. In China etwa nimmt man immer wieder für das eigene autoritäre Herrschaftsmodell in Anspruch, den umständlichen Verfahren liberaler Demokratien auch mit Blick auf die Herausforderungen des Klimawandels überlegen zu sein und findet damit in vielen Teilen der Welt durchaus positive Resonanz. Strohschneider weist aber zu Recht darauf hin, dass es möglicherweise ein Fehlschluss sei zu hoffen, mit dem Außerkraftsetzen demokratischer Prinzipien schneller zu Problemlösungen im Sinne des Klimaschutzes oder der Gesundheit zu gelangen. Das Überspringen des demokratischen Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesses berge eher die Gefahr, Reaktanz, Elitenhass und irrationalen Widerstand hervorzurufen, an denen die Klimapolitik scheitern könne. Und ob es wirklich gelingt, mit autoritärem Regieren sinnvolle Prozesse der Klimatransformation zu beschleunigen, steht dahin. Auch China hat dafür den Beweis noch keineswegs erbracht. Seine extrem rigide Corona-Politik zum Beispiel, die in Deutschland bei manchem Wissenschaftler als „Zero-Covid“-Strategie durchaus in hohem Kurs stand, ist jedenfalls krachend gescheitert.
Ein reflektiertes Verständnis von wissenschaftlicher Politikberatung anerkennt, so Strohschneider, die Eigenlogiken von Wissenschaft und Politik. Politik entscheidet, welche Schlussfolgerungen sie aus wissenschaftlicher Expertise zieht. Die Wissenschaft ihrerseits wird von politischen Bedenklichkeiten freigestellt, um den Strom immer wieder neuer Erkenntnisse zu erzeugen, der letzten Endes auch der Politik nutzen kann. Politikberatung kann informieren und empfehlen. Entscheiden aber muss die Politik.
Peter Strohschneider ist ein reflektiertes und informatives Buch gelungen, dass einen neuen Blick auf aktuelle Debatten erlaubt, aber auch Wichtiges zum grundsätzlichen Verhältnis von Wissenschaft und Politik in der modernen Gesellschaft sagt. Es ist, obwohl wissenschaftlich argumentierend, gut lesbar. Ihm sind viele Leser zu wünschen, nicht zuletzt auch im Kreis der kritischen und politisch engagierten Wissenschaft.
Matthias Schulze-Böing
Annette, ein Heldinnenepos
Ein Plädoyer gegen den Krieg und für den Mut setzt ein junges Schauspieler- und Schauspielerinnen- Ensemble des Staatstheaters Darmstadt und begeistert das Publikum mit dem zwei Stunden und 45 Minuten dauernden Theaterstück „Annette, ein Heldinnenepos“. Mit überraschender Leichtigkeit wird auf der Bühne in Verstexten mit Licht,- Musik- und Filmeffekten das Leben einer echten Heldin der französischen Résistance dargestellt, die für die Rettung zweier jüdischer Jugendlicher vor dem Tod von Yad Vashem später den Ehrentitel „Gerechte unter den Völkern“ ausgezeichnet wurde.
Grundlage des Schauspiels ist der 2020 im Verlag Matthes & Seitz Berlin erschiene gleichnamige Roman von Anne Weber, die 1964 in Offenbach/ Main geboren wurde. Sie ging mit 18 Jahren als Au Pair nach Frankreich, hat Französische Literatur und Komparatistik an der Sorbonne-Universität studiert und in verschiedenen Verlagen gearbeitet. Seit 1983 lebt sie als freie Autorin und Übersetzerin in Paris. Neben verschiedenen Auszeichnungen erhielt sie für das Buch „Annette ein Heldinneneopos“ 2020 den Deutschen Buchpreis.
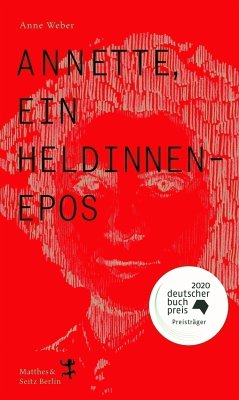
Annette, ein Heldinnenepos
Anne Weber
Verlag Matthes & Seitz, Berlin 2020., 22 Euro.
ISBN 9783957578457
Die Handlung des Epos ist angelehnt an das Leben der Anne Meaumanoir, die 1923 bis 2022 lebte. Sie war Medizinerin und hat als eine der französischen Kämpferinnen der Résistance Juden und politisch Verfolgte unterstützt und gerettet. Im Roman wird die Heldin „Annette“ genannt.
„Annette“, ist Kind einer Arbeiterfamilie und wird Anfang der 1920er Jahre in der Bretagne geboren. Sie studiert Medizin und wird schon als junge Frau Mitglied der Résistance, des französischen Widerstandes gegen den Nationalsozialismus. Die Überzeugung, dass die Welt ein gerechterer Ort sein sollte, ist eine ihrer wichtigsten Grundwerte und so versucht sie sich zu engagieren, mit Botengängen, Unterstützungsleistungen und dem Verstecken jüdischer Menschen, die von der Deportation bedroht sind.
Nach dem Ende der deutschen Besatzung und einer kurzen Zeit der Ruhe und dem Glück wird Annette jedoch bewusst, dass es auch im befreiten Frankreich noch vieles gibt, was bekämpft werden muss. Sie heiratet Joseph, mit dem sie zwei Kinder hat und arbeitet als Medizinerin.
Mit Beginn des Algerienkrieges in der Kolonie von Frankreich, Anfang der 1950er Jahre, wird Annette von der Nationalen Befreiungsfront angeworben und wird wieder im Widerstand und damit im politischen Untergrund aktiv. Im Jahr 1959 wird sie wegen ihres Engagements auf Seiten der algerischen Unabhängigkeitsbewegung zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt.
Anne Meaumanoir, genannt „Annette“ engagierte sich bis zuletzt mit Vorträgen gegen Nationalismus, Rassismus und religiösen Fanatismus.
Die tief spürbare Darstellung „Annettes“ Engagements, ihr Mut und ihre Haltung sind ergreifender Teil des Schauspiels in Darmstadt, genauso wie auch ihre Widersprüche, Verluste und Ängste ihres immer politisch aktiven Lebens sind eine Theater-Empfehlung wert.
https://www.staatstheater-darmstadt.de/ihrbesuch/#karten-und-vorverkauf
Rosi Haus
Lust auf morgen
Das tut gut. Endlich macht Lesen wieder mal so richtig Spaß. Kein Wunder, kämpft „Spiegel-Autor“ Ullrich Fichtner doch vom Vorwort seines neuen Buches an gegen die weit verbreitete Weltuntergangsstimmung. Ja doch, die Zeitläufte halten angesichts von Klimawandel, internationalen Krisen, disruptiven Technologien und wirtschaftlicher Unsicherheit so manche Risiken und Gefahren bereit. Sie beinhalten über die möglichen gewaltigen Entwicklungsfortschritte aber auch Chancen, die es zu nutzen gilt. Unter dem Titel „Geboren für die großen Chancen – Über die Welt, die uns und unsere Kinder erwartet“ liefert Fichtner Argumente gegen den Pessimismus unserer Zeit und führt dabei auf, dass die Zukunft nicht als Verhängnis, sondern als Möglichkeit gesehen werden soll. Er plädiert dabei für einen konstruktiven Streit um die besten Lösungen und räumt zugleich ein, dass auch er sich auf seinem Weg in die Zukunft täuschen kann.
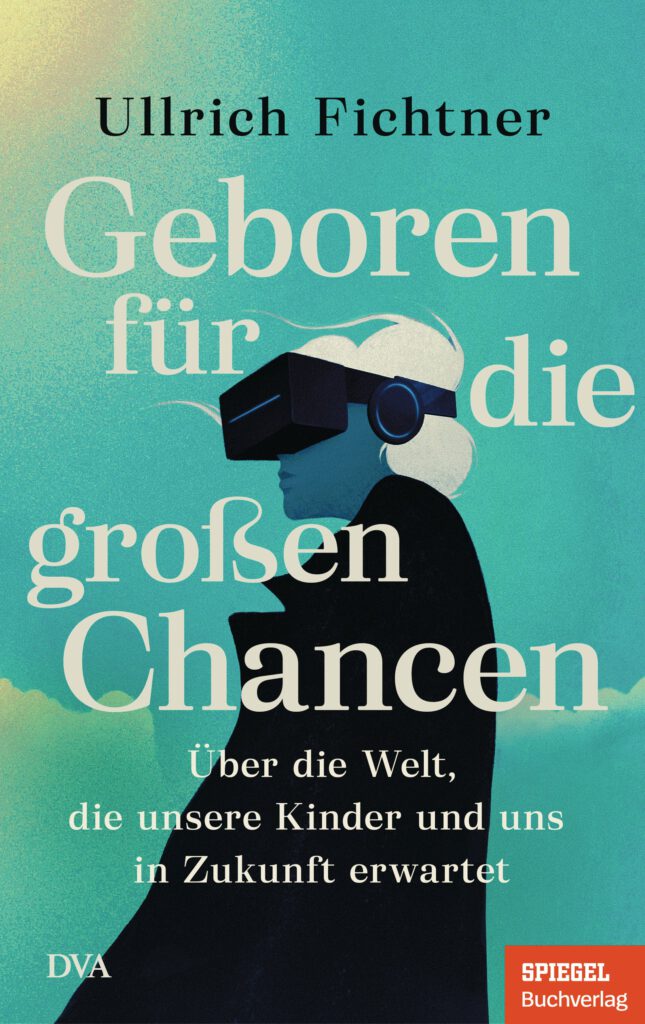
Geboren für die großen Chancen
Über die Welt, die unsere Kinder und uns in Zukunft erwartet
Ullrich Fichtner,
Deutsche-Verlags-Anstalt München 2023, 24 Euro
ISBN 9783421070159
Im digitalen Debattenraum „Basecamp“ sagt Fichtner, was ihn angetrieben hat: „Die Zeit war reif für das Buch, weil ich im Oktober 2021 eine Umfrage gelesen habe, aus der hervorging, dass Dreiviertel der deutschen Erwachsenen glauben, dass es den Kindern der Zukunft schlechter gehen werde als ihnen selbst. Das fand ich so empörend, dass ich gedacht habe: Da muss man mal gegenhalten.“ Zunächst plädiert Fichtner für eine Korrektur der Irrtümer, mit denen die Menschheit diesen Planeten an den Rand des Kollapses geführt hat: „Der Mensch hat mehr Angst vor Armut als vor dem Aussterben.“ Diese Aussage kann man wohl unterschreiben, was angesichts der wenig belegten Zuversicht bei den Themen Energieversorgung, Kreislaufwirtschaft mit endloser Wiederverwertung und Verstädterung schon schwerer fällt.
Letztlich präsentiert Fichtner einen Text, der mal Zustimmung und mal Skepsis hervorruft, mit dem sich aber die eigene Denke überprüfen lässt. Letztlich stellt der Autor fest, dass es auf wichtige Fragen kaum eindeutig richtige oder falsche Antworten gebe. Es müsse gestritten werden, und zwar auf der Grundlage von Welten, Weltanschauungen und Menschenbildern. So überwiegt für Fichtner beim Blick in die Zukunft der Optimismus. Darauf lässt man sich gerne ein. Ein Vorgeschmack gefällig?
Hier ein bearbeiteter Auszug des „Spiegel“-Bestsellers.
Frank Pröse
Streitschrift gegen die woke Linke
Susanne Schröter, Professorin für Ethnologie und Direktorin des Forschungszentrums Globaler Islam an der Goethe-Universität Frankfurt, setzt sich seit vielen Jahren für eine differenzierten und realistischen Blick auf den Islam ein. Sie warnt vor den Gefahren des Islamismus und kritisiert die Politik der Islamverbände, denen der Staat ihrer Meinung nach allzu oft auf dem Leim gehe. Die streitbare Professorin hat sich damit nicht nur Freunde gemacht. Linke Aktivisten sind immer wieder mit dem Vorwurf der „Islamophobie“ und des „antimuslimischen Rassismus“ zur Stelle und versuchen Tagungen und öffentliche Diskussionsrunden zu stören, die Schröter mit ihrem Forschungszentrum veranstaltet. Oft ist Polizeischutz notwendig. Schröter hat insofern eigene Erfahrungen mit einer neuen Intoleranz, die sich an den Universitäten, im Kulturbetrieb, zunehmend aber auch in der gesamten Gesellschaft ausbreitet. Eine Intoleranz, die nicht nur Begriffe tabuisiert und Vorschriften für den Sprachgebrauch erlassen will, sondern inzwischen selbst wissenschaftliche Fragestellungen für illegitim erklärt, wenn sie nicht mit den Dogmen vermeintlich fortschrittlicher Weltanschauung konform gehen.
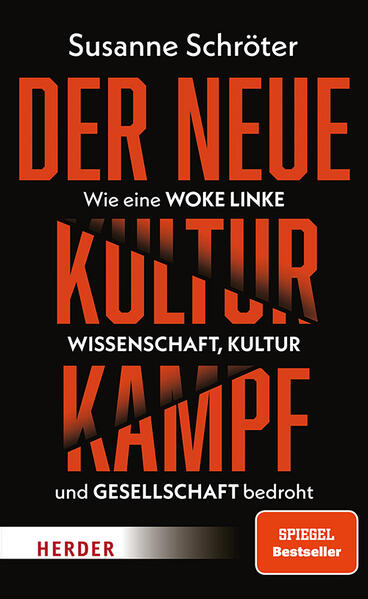
Der neue Kulturkampf
Wie eine woke Linke Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft bedroht.
Susanne Schröter
Herder Verlag Freiburg 2024, 20 Euro
ISBN 978-3-451-39710-3
In ihrem neuen Buch „Der neue Kulturkampf“ versucht Schröter zu zeigen, dass es sich bei diesen Konflikten nicht nur um ein paar Aufgeregtheiten im akademischen Milieu handelt, sondern um ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, das sich zunehmend zu einer Gefahr für die Freiheit und den gesellschaftlichen Zusammenhalt auswächst. Es ist eine Streitschrift, erkennbar auch durch eigene Betroffenheit motiviert. Dennoch ist das Buch überaus informativ, gut und verständlich geschrieben und in der Argumentation überwiegend sehr überzeugend.
In der Debatte um den Islam sei es, wie Schröter schreibt, konservativen Verbänden gelungen, Tabuzonen zu errichten, die Frage nach der Rolle der Frau, das Tragen des Kopftuchs und der Haltung des Islam zu Homosexualität als „antimuslimischen Rassismus“ zu diskreditieren und liberale Muslime auszugrenzen. Das Schlimme dabei, Wissenschaftler, die es eigentlich besser wissen müssten, ließen sich immer wieder vor den Karren des konservativen Islam spannen und versuchten, kritische Stimmen aus dem wissenschaftlichen Diskurs herauszuhalten. Weil Muslime als benachteiligte Minderheit angesehen werden, werden kritische Befunde zur Realität des Islam als latent diskriminierend angesehen und deshalb ausgeblendet. Wunschdenken schlägt Wahrheit.
Wissenschaft verliert, wie Schröter zeigt, durch eine zu große Nähe zu normativen Bekenntnissen ihre Unabhängigkeit und Objektivität. Politischer Aktivismus bemächtige sich zunehmend nicht nur der immer schon diskussions- und meinungsfreudigen Sozial- und Geisteswissenschaften, sondern der Universitäten in Gänze, dies oft auf durchaus subtile Weise. Interessant ist dabei der Hinweis, dass das sehr verbreitete Formulieren von Leitbildern für Universitäten zum Einfallstor für Versuche der politischen Steuerung von Wissenschaft im Sinne der „woken“ Ideologie werden kann. Wenn in den Leitbildern ganz unverfänglich ein Bekenntnis zu Geschlechtergerechtigkeit, Diskriminierungsfreiheit und Diversität abgegeben werden, rücke naturgemäß das klassische Ziel der Universität, die möglichst ungehinderte und an der Wahrheit orientierte Suche nach Erkenntnissen in den Hintergrund. Mehr noch, Forschungsinhalte würden inzwischen mit Hinweis auf Universitätsleitbilder als illegitim abgelehnt. Die kritische Forschung zum Islam wird unter Diskriminierungsverdacht gestellt, der Hinweis auf die Erkenntnisse der Biologie zur Zweigeschlechtlichkeit höherer Lebewesen und damit auch des Menschen gerät unter das Verdikt der „Transphobie“, also irgendetwas zwischen krankhaftem Wahn und offener Bösartigkeit. Wenn die Universität sich in ihrem Leitbild zur Nichtdiskriminierung und Vielfalt bekannt hat, sei es dann nur ein kurzer Schritt, mit Hinweis auf das Leitbild das Verbot bestimmter Forschungen, Vorträge oder Konferenzen zu fordern.
Für viele besonders informativ dürften die Ausführung zum „postkolonialen“ Denkansatz sein, mit seinem scharfen Gegensatz zwischen der Welt des kolonisierten „globalen Südens“ und den Ländern des Westens, den ehemaligen Kolonialherren. Das damit verbundene Beharren auf einer andauernden kolonialen Schuld hat sich als überaus anschlussfähig und wirksam erwiesen, vom Nahostkonflikt bis hin zu weltpolitischen Verwerfungen, bei denen Autokratien wie China und Russland im Kielwasser der Kolonialismuskritik Einfluss im globalen Süden zu gewinnen versuchen. Schröter zeigt sehr schön, dass auch dieses für das „woke“ Denken sehr zentrale Denkgebäude im Kern mehr Ideologie als Wissenschaft ist. Damit das Schwarz-Weiß-Bild des Postkolonialismus stimmt, werden schlechtes Regieren, Gewalt und Korruption in Ländern des globalen Südens ebenso ausgeblendet wie die Tatsache, dass es dort schon vor der Kolonialisierung durch die Europäer Sklavenhandel, Unterdrückung und Ausbeutung gab. Das macht es zur Ideologie – falsches Denken zu praktischen Zwecken, die man bei der „woken“ Linken durchaus auch findet, wie Schröter beschreibt.
Eine Vielzahl von gut bezahlten Stellen im öffentlichen Dienst für alle möglichen Beauftragten, aus Steuermitteln geförderten Verbände und „Nicht-Regierungs-Organisationen“ verdanken sich durchsetzungsstarker Minderheiten- und Identitätspolitik auf allen politischen Ebenen. Auf diese Weise sei Schröter zufolge eine regelrechte „Anti-Rassismus-Industrie“ entstanden, die den gesellschaftlichen Daueralarm pflege und dabei aber doch sehr wirksam die eigenen Schäfchen ins Trockene bringe.
„Woke“ heißt, wörtlich übersetzt „aufgeweckt“, wogegen keiner etwas haben dürfte. Politisch ist „woke“ inzwischen jedoch zum Kennzeichen einer intoleranten Ideologie geworden, die mit geradezu hysterischer Akribie nach kleinsten Zeichen der Abweichung vom normativ für richtig Gehaltenen sucht und einen für eine freiheitliche Gesellschaft tödlichen Konformitätsdruck erzeugt. Der konservative Islam, die Genderpolitik und das postkoloniale Denken haben, wie Schröter zeigt, Geltungsansprüche mit totalitären Zügen. Kritiker werden nicht beim Argument genommen, sondern es werden ihnen bösartige und feindliche Intentionen unterstellt. Die logische Antwort ist dann nicht das vielleicht bessere Argument, sondern die Verächtlichmachung der Kritiker und das „Canceln“ ihrer Aktivitäten.
Schröters Buch zu diesen Phänomenen des Zeitgeistes ist informativ. Dass es an vielen Stellen eine Streitschrift in eigener Sache ist, schmälert seinen Informationswert nicht. Etwas mehr analytische Distanz hätte allerdings an manchen Stellen des Buches gutgetan. Wünschen würde man sich zudem Bemühungen, die von Schröter gut beschriebenen Phänomene einer intoleranten und aggressiven Bewegung in die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung einzuordnen. Wenn bestimmte Ideologien so viel Einfluss und Durchsetzungskraft entwickeln, möchte man wissen, warum sie entstanden sind und was ihnen so viel politische Kraft gibt. Ist es eine Regression in Irrationalismus oder ist es Teil einer der vielen Häutungen des Kapitalismus, die einen neuen Zyklus der Verwertung auf globaler Ebene ankündigt (Stichwort: digitaler Kapitalismus), zu dem die „woke“ Ideologie die Begleitmusik orchestriert? Dazu gibt es kaum etwas in dem Band. Vielleicht ist das der Stoff für ein weiteres Buch.
Matthias Schulze-Böing
Bernie wiegelt auf
Was für ein Auftritt bei Maischberger! Da hat einer etwas zu sagen, hat eine Botschaft und spricht noch Klartext. Was spielte es für eine Rolle, dass Bernie Sanders dreimal beim Anlauf aufs US-Präsidentenamt gescheiterter Linksaußen unter den Demokraten in Washington nicht mehr in der vordersten Reihe steht? Als Mitglied des US-Senats ist er aber ein Insider eines demokratischen Systems, dass er vor allem in den USA extrem gefährdet sieht; nicht nur durch Republikaner-Star Donald Trump, sondern auch durch die zunehmende Ungleichheit und Ungerechtigkeit zulasten des Mittelstands, der sich immer öfter nicht mehr in der Lage sieht, mit seiner Hände Arbeit ein auskömmliches Leben zu finanzieren. Früher hätten Firmenchefs im Durchschnitt 30- bis 40-mal so viel wie ihre Angestellten verdient, heute sei es das Vierhundertfache, schimpft Sanders.
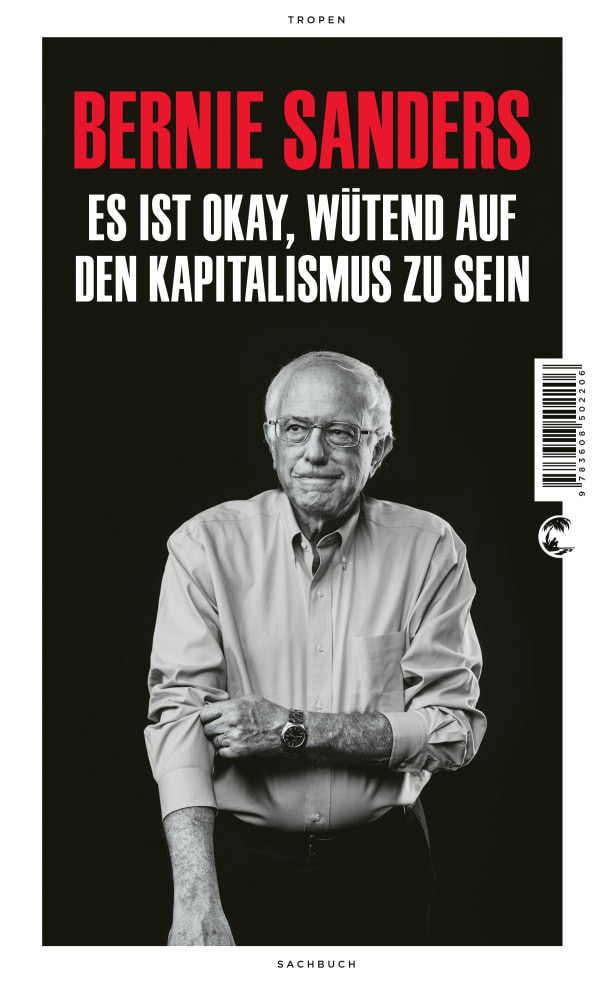
Es ist okay, wütend auf den Kapitalismus zu sein
Bernie Sanders,
Tropen Verlag Stuttgart,
ISBN 9783608502206
„Über-Capitalism“ nennt er die systemimmanente Gier und Verachtung für alle Regeln des Anstands in seinem neuesten Buch „Es ist okay, wütend auf den Kapitalismus zu sein“. Der inzwischen 82-jährige Autor mehrerer Bestseller nimmt darin die Superreichen und Oligarchen aufs Korn, die nach seiner Ansicht die Welt in unter sich aufteilen könnten, weil der Kapitalismus eben nicht funktioniere. In diese seine Theorie webt Sanders auch andere Krisen dieser Tage wie den Rechtspopulismus, die Migration oder die Kriege ein.
„Es gibt nichts Amerikanischeres, als ein System, das uns im Stich gelassen hat, zu hinterfragen , um die Gesellschaft aufzubauen, die wir und zukünftige Generationen verdienen“, schreibt Sanders im Vorwort. Sanders, der in USA gefeiert wird wie ein Popstar, wiegelt die Leserschaft auf. Es sei an der Zeit, gesamtgesellschaftliche Fragen zu stellen. Darum geht es in diesem Buch, in dem Sanders ein Konzept vorstellt für schrittweise Veränderungen hin zu einer Wirtschaftsdemokratie mit mehr Mitspracherechten für die Beschäftigten. Konkret wird Sanders beispielsweise bei der Job-Beschaffung, der Gesundheitsfürsorge, dem lebenslangen Lernen, dem Einebnen ungleicher Einkommen mithilfe eines progressiven Steuersystems, das vor allem Reichen und Großunternehmen „einen fairen Beitrag“ abverlangt.
Das Buch ist ein eindrucksvolles Zeugnis seines politischen Lebenswerks und ein kämpferischer Appell an die nächste Generation, das hyperkapitalistische System grundsätzlich in Frage zu stellen. Im sowohl lässigen wie aufmunternden Titel „Es ist okay, wütend auf den Kapitalismus zu sein“ hat Sanders seine persönliche Sicht auf die Ereignisse und seine persönliche Agenda für eine bessere Zukunft durch eine Graswurzelbewegung formuliert. Dass Sanders, wie in den Wahlkämpfen bewiesen, das Zeug zum Menschenfänger hat, dürfte jeder erfahren, der sich mit seinem neuesten Buch beschäftigt. Es wird freilich auch jene geben, die den utopischen Geist und Veränderungswillen von Sanders als naiv abtun werden. Doch es tut gut zu lesen, wie sich ein weiser, alter Mann im Kampf für eine gerechtere Welt treu bleibt.
Frank Pröse
Nationales Interesse – ein verlässlicher Kompass?
In seiner Studie „Leidenschaften und Interessen“ aus dem Jahr 1977 hat der Ökonom Albert O. Hirschmann gezeigt, wie der Begriff des „Interesses“ zu Beginn der Neuzeit zum Zentralbegriff der politischen Staatslehre wurde. Er verkörperte das Gegenmodell zu den Leidenschaften des Glaubens, die in den Religionskriegen des 17. Jahrhunderts Deutschland und Europa ins Chaos gestürzt hatten. Interessen wurden so etwas wie die verborgene Kraft, die das menschliche Handeln, wechselnde Befindlichkeiten und Konflikte erklärbar machten. Der Begriff des Interesses öffnete zudem einen gedanklichen Raum für Kompromisse, während das Universum der Leidenschaften nur den richtigen und den falschen Glauben kannte. Vielfältige Motive auf Interessen zurückzuführen ist aber immer auch eine „Reduktion von Komplexität“, wie es der Soziologe Niklas Luhmann ausdrücken würde, eine Reduktion, die stets das Risiko mitführt, Wichtiges zu übersehen und von Entwicklungen überrascht zu werden, die in der Mechanik der Interessen nicht zu erwarten waren. Ganz abgesehen davon, dass eine Politik der nackten Interessen schnell jede Gefolgschaft verlieren würde, wenn sie sich nicht auch an Werte bindet und damit Legitimität verschafft.
Vor diesem Hintergrund einige Anmerkungen zu Klaus von Dohnanyis Buch „Nationale Interessen. Orientierung für deutsche und europäische Politik in Zeiten globaler Umbrüche“. Darin formuliert der „Elder Statesman“ der Sozialdemokratie, Staatssekretär, Bildungs- und Wissenschaftsminister in der Regierung von Willy Brandt und den 1980er Jahren Erster Bürgermeister von Hamburg den Anspruch,„Orientierung für deutsche und europäische Politik in Zeiten globaler Umbrüche“ zu geben. Er plädiert dabei für einen nüchternen Blick auf Interessen der Nationen und warnt davor, sich von einem sentimentalen Wertediskurs in die Irre führen zu lassen. Das Buch ist kurz vor dem militärischen Überfall Russlands auf die Ukraine abgeschlossen worden und spiegelt Einschätzungen eines bedeutenden und einflussreichen Sozialdemokraten am Vorabend der „Zeitenwende“ zu einem heißen Krieg auf europäischem Boden. Das macht es auch zu einem Zeitdokument, das Einblick gibt in den „Mindset“ von in der Tradition der Friedenspolitik Willy Brandts stehenden Sozialdemokraten, die ihren inneren Kompass neu justieren müssen, nachdem die Politik, den Frieden durch Kooperation, wirtschaftliche Verflechtung und kulturellen Austausch zu sichern, zumindest vorläufig an ein Ende gekommen zu sein scheint.
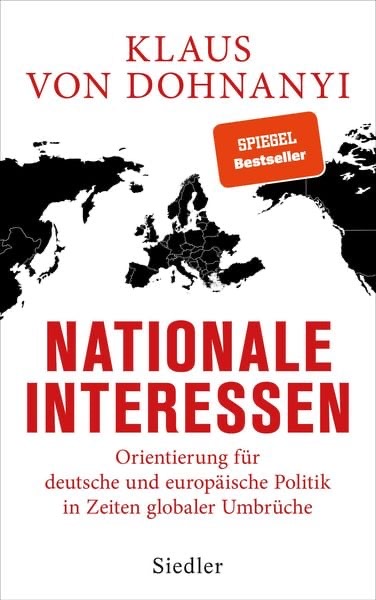
Nationale Interessen.
Orientierung für deutsche und europäische Politik in Zeiten globaler Umbrüche.
Klaus von Dohnanyi, Siedler-Verlag, München 2022, 22 Euro (gebundene Ausgabe)
ISBN 978-3-8275-0154-7
Dohnanyi grenzt sich ab von einem „billigen Anti-Amerikanismus“, geht aber doch sehr kritisch mit den USA als größter Weltmacht ins Gericht. Die Neigung zur Selbstbezogenheit in Verbindung mit dem Hang zu imperialen Übergriffen sieht er schon sehr früh im politischen Selbstverständnis der USA verankert, in ihrem „Exzeptionalismus“, in dem sie sich als auserwählte Nation sieht, mit der Mission, ihr Modell von Demokratie, Freiheitsrechten und Kapitalismus in aller Welt zu verbreiten. Amerikanische Politik ist, wie Dohnanyi sie sieht, ausschließlich an den Interessen der USA in ihrer imperialen Rolle als Weltmacht ausgerichtet. Demokratische Werte werden, so Dohnanyi, zitiert, wenn sie nützlich sind und Gefolgschaft sichern, aber ebenso schnell wieder verraten, wenn das Machtkalkül die Kooperation mit Autokraten und Diktatoren als zweckmäßig erscheinen lässt. Auf eine „Wertegemeinschaft“ mit den USA zu setzen sei sträfliche Naivität.
Die NATO ist in den Augen Dohnanyis wenig mehr als ein Instrument der USA zu Sicherung ihrer Dominanz und ihrer wirtschaftlichen und militärischen Interessen. Misstrauen ist hier, so scheint es, die einzig gebotene Haltung. Dohnanyi sieht das Verhalten der NATO nach dem Zusammenbruch des Sozialismus und der Sowjetunion 1990 als Beleg für diese These. Er macht sich dafür ein (bisher vor allem auf der äußersten Linken verbreitetes) Narrativ zu eigen, nach dem der Westen entgegen seinen Zusagen an Gorbatschow in den Endzügen der Sowjetunion die Ausdehnung der NATO nach Osten vorangetrieben und damit Russland gezielt in die Enge getrieben habe. Nun ist es äußerst strittig, ob es eine solche Zusage zur Selbstbegrenzung der NATO jemals gegeben hat. Nicht zu übersehen ist auch, dass es das Verhalten des nachsowjetischen Russlands war, das die ehemaligen Mitgliedstaaten des Warschauer Pakts in Mittel-, Ost- und Südosteuropa sowie die ehemaligen Sowjetrepubliken im Baltikum dazu gebracht hat, ihre Sicherheit in der Mitgliedschaft in der NATO zu suchen, teilweise bestätigt durch Volksabstimmungen mit überwältigenden Mehrheiten für den Beitrittsantrag. Von Tschetschenien und den Tschetschenienkriegen, die schon früh gezeigt haben, mit welch brutalen Mitteln Russland seine Interessen durchzusetzen gewillt ist, wird im ganzen Band bezeichnenderweise nicht einmal gesprochen. Man hat nicht das Gefühl, dass der Autor sich hier um ein ausgewogenes Urteil bemüht. Die Quellen, die er zum Beleg seiner Thesen heranzieht, sind sehr selektiv ausgewählt. Einen Überblick zur Debatte zu diesen brisanten Themen ist von Dohnanyi wohl auch gar nicht gewollt.
Auch die These, dass man Russland durch das Ignorieren seiner vitaler Interessen der Atommacht und seine Kränkung durch ständiges Messen an westlichen Maßstäben von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit Europa entfremdet und an die Seite Chinas getrieben habe, entwirft ein sehr angestrengtes Opfernarrativ, dem man widersprechen muss. Wenn Dohnanyi behauptet, die Aufnahme der Ukraine in die NATO habe nach der Krim-Besetzung gewissermaßen unmittelbar bevorgestanden, ist das eindeutig falsch. Nach dem Angriff Russlands vom 24. Februar könnte man eher zur Auffassung gelangen, dass dieser möglicherweise zu vermeiden gewesen wäre, wenn man der ohnehin massiv bedrängten Ukraine den Beitritt zur NATO nicht verweigert hätte. Hier strickt Dohnanyi an Legenden, die den Verlautbarungen der Kreml-Propaganda in ihrer Wahrheitsferne kaum nachstehen.
Dohnanyis Urteil ist in dieser Sache denkbar unausgewogen und nicht weit von dem „billigen Anti-Amerikanismus“ entfernt, von dem er sich doch zu Anfang seines Buches so wohltuend distanziert hat. Das ist schade, denn bei manchen Fragen hat er durchaus einen Punkt, etwa bei der Analyse der Weltmachtstrategie der USA und dem Hinweis auf die Instrumentalisierung Europas für den Konflikt zwischen den USA und China.
Der Krieg in der Ukraine, wie schon zuvor die Auseinandersetzungen auf dem Westbalkan und die gescheiterte Mission in Afghanistan haben die Schwäche Europas und der Europäischen Union offengelegt. Europa ist, wenn es darauf ankommt, uneinig und spielt trotz einer Bevölkerung von fast einer halben Milliarde Menschen und einem Bruttoinlandsprodukt von fast 15 Billionen Euro in den geopolitischen Spannungsfeldern keine eigene Rolle. Wenn man die Marginalisierung Europas beenden will, wäre es eigentlich sinnvoller zu fragen, wie es stark und handlungsfähig werden kann, als – wie Dohnanyi – den USA zum Vorwurf zu machen, dass sie ihren Vorteil suchen. Wer wollte es einem Hegemon vom Format der USA verdenken, wenn er die Chancen entschlossen nutzt, die sich durch das transatlantische Ungleichgewicht und das Fehlen eines europäischen Gegenparts bieten. Dazu kommt, die USA haben sich Europa gegenüber doch eher als benevolenter, freundlicher Hegemon verhalten, wenn man es mit dem Verhalten anderer Großmächte in deren Einflussbereichen vergleicht. So ganz nebensächlich scheint die gemeinsame Wertbasis der Demokratien des Westens doch nicht zu sein.
Wie also kann Europa stärker werden? Die Gedanken, die Dohnanyi zu dieser Frage entwickelt, sind erfreulicherweise weniger vordergründig und einseitig als seine Russlandanalysen. Hier ermöglichen die Erfahrungen eines langen Politikerlebens vielfältige und interessante Einblicke. Dohnanyi sieht die aktuelle Verfassung der EU durchaus kritisch – zu viel Zentralismus, zu viel Bürokratie. In einer „ever closer union“ und der damit verbundenen Verlagerung von Kompetenzen aus den Nationalstaaten nach Brüssel sieht er keine gute Perspektive, auch nicht in der zuerst von Joschka Fischer formulierten Vision einer europäischen Föderation, also eines Bundesstaates, der an die Stelle des bisherigen Staatenbundes tritt. Dohnanyi sieht sich mit der Vision eines „Europas der Vaterländer“ eher in der Tradition von Charles de Gaulle. Die Nationalstaaten seien die politische Ebene, die am ehesten gesellschaftlichen Zusammenhalt und demokratische Legitimation gewährleisten kann. Deshalb solle man sie stärken und ihre Entscheidungsspielräume erhalten und wieder herstellen, wo sie durch Europarecht allzu sehr eingeengt seien.
Das sei etwa im Wettbewerbsrecht der Fall, wo die EU viel zu oft sinnvolle Unternehmensfusionen durchkreuze. Es gelte auch für die Frage, wie Mitgliedstaaten innerhalb der EU Rechtsstaatlichkeit und Demokratie auslegen. Wenn Polen einen Disziplinarhof für Richter einführen will und damit die Unabhängigkeit der Justiz einschränkt, solle man es gewähren lassen, so Dohnany mehr oder weniger unverblümt. Jedes Land habe nun mal seine eigenen Erfahrungen und seine besondere Kultur, da sei Vielfalt in fast jeder Hinsicht besser als strikte Europanormen. Hier muss man als Leser doch ein wenig die Stirn runzeln. Denn Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zur Disposition zu stellen, würde doch an die Wurzeln des Europaverständnisses gehen, wie wir es kennen.
Interessant ist Dohnanyis Vorschlag, statt einer mehr oder weniger offenen fiskalischen Transferunion Verfahren der geordneten Staatsinsolvenz einzuführen. Das stärke die Eigenverantwortung und damit nationale Selbstbestimmung.
Dohnanyi beschwört die Kooperation souveräner Nationalstaaten als Weg für ein starkes, gemeinsames Auftreten von Europa in der Welt. Ist das realistisch? Ist es nicht ein Paradox, ein starkes Europa, das den imperialen Strategien Amerikas, Russlands und Chinas etwas entgegensetzen kann, zu fordern und gleichzeitig die Übertragung von Souveränität von den Nationalstaaten auf Europa abzulehnen? Dohnanyi stellt sich diesen Fragen nicht so richtig. Auch geht er kaum auf die Frage einer gemeinsamen europäischen Verteidigung ein. Die für die Zukunft wichtigen Fragen des sozialen Ausgleichs und einer Sozialunion lässt er ebenso beiseite wie Fragen einer gemeinsamen europäischen Migrations- und Flüchtlingspolitik. Ganz Sozialdemokrat alter Schule ist Dohnanyi, wenn er eine entschiedenere staatliche Industriepolitik in Europa fordert. Auch hier könnte er einen Punkt haben, auch wenn es neben Airbus bisher nicht allzu viele Erfolgsgeschichten der Industriepolitik in Europa gibt. Bei Mikroelektronik und „grünen“ Technologien ist ein neuer Anlauf notwendig. Das ist unbestritten.
Dohnanyis „Nationale Interessen“ überzeugen in manchen Punkten durch nüchterne Analyse und politischen Realismus. Wichtig ist sein Hinweis auf die Tatsache, dass der Nationalstaat nach wie vor unüberholt ist, was die Fähigkeit zur Gewährleistung gesellschaftlichen Zusammenhalts und sozialen Ausgleichs angeht. Die Corona-Krise hat dies erst jüngst eindrucksvoll bestätigt. Dohnanyi zieht aus dieser Einsicht allerdings nicht unbedingt die richtigen Schlüsse, wenn er vorschlägt, nationalen Interessen konsequenterweise absoluten Vorrang zu geben und transnationale Verflechtungen, ob nun NATO, Währungsunion oder anderes, zu begrenzen oder gar zurückzufahren. Er steht hier den Positionen eines linken Neo-Nationalismus nahe, wie er etwa von Oskar Lafontaine, Sarah Wagenknecht und in der Wissenschaft von Wolfgang Streeck seit vielen Jahren vertreten wird. Dieser Neo-Nationalismus verkennt, wie stark gerade Deutschland von globalen Märkten, internationaler Zusammenarbeit und der Verlässlichkeit transnationaler Institutionen abhängig ist. Er verkennt auch die Bedeutung der Westeinbindung Deutschlands für den Erhalt von Freiheit und Demokratie und nicht zuletzt nährt er in Europa und Amerika Misstrauen in die Motive und die Verlässlichkeit deutscher Politik. Nicht Neo-Nationalismus, sondern der Einsatz für ein starkes und einiges Europa liegt im nationalen Interesse Deutschlands.
Grundlage dafür ist nicht ein naiver Internationalismus, sondern die nüchterne Einsicht, dass die Nationalstaaten des Kontinents für sich genommen zu klein und zu schwach sind, um sich alleine den geopolitischen Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft zu stellen. Es braucht etwas Drittes und das kann nur eine weiter entwickelte Europäische Union sein. Man kann nicht beides haben, ein starkes Europa und Nationalstaaten mit uneingeschränkter Souveränität. Hier ist Dohnanyis Ansatz leider nicht auf der Höhe der Zeit.
Was die russische Frage angeht, bleiben Dohnanyis Ausführungen in einer ärgerlichen Form den Fehlurteilen von Egon Bahr, Oskar Lafontaine und Gerhard Schröder verhaftet. Zugutehalten kann man dem Autor hier nur den Erkenntnisstand vor der russischen Invasion der Ukraine. Er war in Bezug auf die Bereitschaft Russlands, seine Interessen rücksichtslos durchzusetzen, wie viele andere in seiner Partei befangen von Wunschdenken und Illusionen. Was Europa angeht, gibt er interessante Denkanstöße, lässt aber wichtige Fragen unbeantwortet. Es bleibt offen, wie sich Deutschland und Europa aus der misslichen Abhängigkeit von den USA befreien können, ohne entweder schlicht zerrieben zu werden oder aber in neue Abhängigkeit von wesentlich weniger freundlichen Hegemons zu geraten als es die USA immer noch sind.
Matthias Schulze-Böing
Herold der Antimoderne
Auf Youtube gibt es ein Video mit einem Vortrag des konservativen Europapolitikers Otto von Habsburg aus dem Jahr 2003, in der er auf den damals im Westen noch durchaus angesehenen russischen Präsidenten Wladimir Putin eingeht (Über Putin: Wie Otto von Habsburg ihn einschätzte (2003 und 2005) – YouTube). Manche erinnern sich: Zwei Jahre zuvor, am 25. September2001, hatte Putin eine Rede im Bundestag gehalten und dafür von allen Seiten des Parlaments Applaus erhalten. Viele nahmen ihm sein Bekenntnis zur Demokratie damals ab. Sie hofften, dass Putin nach den chaotischen Jahren unter Boris Jelzin Russland stabilisieren und auf einen demokratischen Weg führen würde. Dass der 1999 ins Amt gekommenen Ministerpräsident Putin als erstes einen extrem brutalen Krieg in Tschteschenien geführte hatte, verdrängte man gerne. Zu schön war die Vision eines friedliebenden Russlands als Partner des Westens.
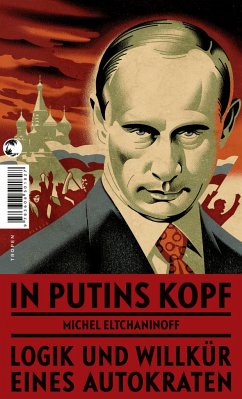
In Putins Kopf
Logik und Willkür eines Autokraten
Michel Eltchaninoff, Tropen, dritte Auflage, Stuttgart 2022, 12 Euro
ISBN 976-3-608-50182-7
Otto von Habsburg weist in seiner Rede gegen den seinerzeitigen Mainstream auf Züge des russischen Präsidenten hin, die in ihm mit Blick auf die Sicherheit Europas alle Alarmglocken zum Klingen brachten. Er berichtet aus den Zeiten der Wende in Ostdeutschland, dass der damals in Dresden eingesetzte KGB-Agent Putin bei politischen Häftlingen in DDR-Gefängnissen als besonders brutal bekannt war. Habsburg geht auch auf eine damals im Westen kaum wahrgenommene Rede ein, die Putin kurz nach Amtsübernahme gehalten hat. Darin hatte er seine geschichtsrevisionistischen Ziele klar formuliert, Russland nicht nur politisch, sondern auch territorial zu der Größe zurückzuführen, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion verloren gegangen war. Habsburg, bei seiner Rede schon 91 Jahre alt, zeigte in einer aus heutiger Sicht extrem klarsichtigen Weise auf, was passieren würde, wenn man Putin auf diesem Weg gewähren lässt und seinen Demokratiebekenntnissen auf den Leim geht. Er sah Parallelen zu Hitlers Aufstieg. Auch den hatte man lange unterschätzt, obwohl er in „Mein Kampf“ schon Jahre vor der Machtergreifung genau beschrieben hat, was seine wahren Ziele sind und wie er sie verwirklichen will.
Der Historiker Timothy Garton Ash berichtet in seinem neuesten Buch „Homelands“ von einer Begegnung im Jahr 1994 mit einem Mann, „short, thick-set, with an unpleasant, vaguely rat-like face“, der sich über die Unabhängigkeit früherer europäischer Sowjetrepubliken erregte, die doch alle nach wie vor zu Russland gehörten. Ort der Begegnung: Sankt Petersburg. Der Gesprächspartner: ein gewisser Wladimir Putin, seines Zeichens Assistent des Bürgermeisters der Stadt.
Es ist also immer gut, genau hinzuhören und hinzuschauen. Manch großes Unheil kündigt sich früh an. Naivität und blindes Vertrauen werden meist hart bestraft.
Michel Eltchaninoff, Chefredakteur des in Frankreich erscheinenden „Philosophie Magazins“, hatte sich nach dem Einmarsch Russlands auf der Krim 2014 darangemacht, die ideologischen Grundlagen Putins zu untersuchen. 2015, in deutscher Ausgabe 2016, hatte er die Ergebnisse unter dem Titel „In Putins Kopf“ veröffentlicht. Vor dem Hintergrund des russischen Überfalls auf die Ukraine im Februar 2022 ist dieser Band nun aktualisiert neu aufgelegt worden.
Eltchaninoff sieht zwei Phasen in der Entwicklung von Putins Denken. In der Anfangsphase seiner Präsidentschaft äußerte er sich durchaus Europa zugewandt, zitierte gelegentlich Kant und distanzierte sich von staatlich verordneten Ideologien, wie sie die Sowjetunion geprägt haben. Gleichwohl ließ er von Anfang an keinen Zweifel daran, dass es ihm darum geht, Russland als Nation zu neuer Größe zu führen. Der Untergang der Sowjetunion hatte für Putin nicht nur zum Verlust von historisch an Russland gebundener Territorien geführt und über Nacht große russische Diasporagemeinden in den nun staatlich unabhängigen früheren Sowjetrepubliken geschaffen. Der Untergang der Sowjetunion mit ihrer marxistischen Heilslehre habe darüber hinaus ein geistiges Vakuum hinterlassen, das zu füllen war – nicht durch westlichen Materialismus und Liberalismus, sondern durch eine Rückbesinnung auf ein Russentum, das er unter den Trümmern der Sowjetideologie wieder hervorholen wollte. Bei Putins Bild der Gemeinsamkeiten von Europa und dem Russland, dass er schaffen wollte, gab es schon damals Akzente, die hätten aufhorchen lassen können. Die gemeinsamen Grundlagen sah Putin nämlich weniger in freiheitlichen und demokratischen Werten, als in den gemeinsamen geschichtlichen Wurzeln in der Antike und der Verankerung im Christentum.
Für Eltchaninoff gab es nach 2004 in seiner zweiten Amtszeit als Präsident und vor allem ab 2012 in seiner dritten Amtszeit eine „konservative Wende“ im Denken Putins, das sich zunehmend vom Westen abwandte und aggressiv-nationalistische Züge annahm. Die islamistischen Anschläge in dieser Zeit, etwa der von Beslan mit fast 400 Toten, hätten bei Putin die endgültige Wende in Richtung Autokratie ausgelöst.
Einen besonderen Einfluss auf Putins Denken haben Eltchaninoff zufolge die Arbeiten des russischen Philosophen Iwan Iljin (1883-1954). Iljin war ein erbitterter Gegner der russischen Revolution und wurde 1922 zusammen mit anderen Intellektuellen aus der Sowjetunion verbannt. Auf einem „Philosophenschiff“ floh er nach Deutschland. Iljin lehnte den Internationalismus und Materialismus der Kommunisten ab. Dagegen setzte er auf ein spirituelles Russentum, als Gegensatz zum Liberalismus und Materialismus Europas. Den Faschismus und den in Deutschland aufkommenden Nationalsozialismus sah er in diesem Sinne durchaus auf seiner Linie. Selbstaufopferung zugunsten des eigenen Volkes ist ein immer wiederkehrendes Motiv. Es gibt, wie Eltchaninoff zeigt, bei Iljin auch viele Verbindungen zu den Denkern der „konservativen Revolution“ im Deutschland der 1920er Jahre, etwa Ernst Jünger und Carl Schmitt.
Putin sorgte dann dafür, dass der Leichnam des 1938 aus Deutschland in die Schweiz weitergezogenen und dort gestorbenen russischen Philosophen nach Russland zurückgeholt und mit allen staatlichen Ehren bestattet wurde. Wie Eltchaninoff berichtet, hat er dadurch eine regelrechte Iljin-Renaissance in Russland ausgelöst. In den tonangebenden Kreisen um Putin gehörte es mehr und mehr zum Komment, Iljin zu lesen und zu zitieren, wann immer sich eine Gelegenheit bot.
Nur konsequent erscheint vor diesem Hintergrund das immer festere Bündnis Putins mit der orthodoxen Kirche mit der er einen verbissenen Kampf gegen die „homosexuelle Kultur“ des Westens führt.
In der Folge hat sich Putin, wie Eltchaninoff zeigt, immer mehr einer eigentümlichen imperialistischen Ideologie verschrieben. Alexander Dugin (*1962), der die Vision eines eurasischen Imperiums unter russischer Führung entwickelte, wurde dabei wohl immer mehr zum intellektuellen Gewährsmann Putins. Auch Carl Schmitt, der Kronjurist Hitlers und Theoretiker des totalen Krieges, werde zumindest in Putins Umfeld häufig gelesen.
Die philosophischen Quellen des Putinismus, schreibt Eltchaninoff, „beruhen alle auf zwei Grundtendenzen: der Idee des Imperiums und der Apologie des Krieges“ (Seite 133). Es passe zur imperialistischen Logik, dass Putin seine Mission zunehmend aggressiv interpretierte. Es ging ihm nicht mehr nur darum, Russland von den Gefahren westlicher Libertinage zu schützen, sondern mehr und mehr auch darum, die konservative Wende zu „exportieren“: „Putin versteht sich als Herold dieser antimodernistischen Welle“ (Seite 166).
Der Band von Etchaninoff zeigt, wie sich Putin von einem Technokraten der Macht allmählich zu einem Herrscher entwickelte, der sich um ein ideologisches Fundament für seine Politik bemühte, das völkische und nationalistische Elemente hat, vor allem aber von der Abgrenzung gegen die Werte und die Kultur des Westens lebt, worin sich inzwischen nach allem was man sieht, auch so etwas wie eine ideologische Brücke zum politischen Islam des Iran und zur nach wie vor marxistischen Parteidiktatur in China herausbildet. Das wird sehr plausibel dargestellt und man lernt einiges über Denker, die hierzulande eher nicht zum Kanon der philosophischen Lektüre gehören. Etwas mehr hätte man allerdings gerne erfahren über die merkwürdige Allianz des im sowjetischen Geheimdienst groß gewordenen Putin mit dem orthodoxen Klerus, der ja mit dem Patriarchen Kyrill auch von einem ehemaligen KGB-Agenten geführt wird. Gibt es religiöse Motive im Denken Putins oder wird die Religion nur ideologisch instrumentalisiert? Stoff für weitere Studien!
Eltchaninoff hat ein kompaktes, gut lesbares, informatives, und leider weiterhin hochaktuelles Buch geschrieben, das dazu beitragen kann, das aktuelle Russland unter Putin etwas besser zu verstehen.
Matthias Schulze-Böing
Das Tollhaus seziert
1918, 1933, 1945 oder 1989: Eine Handvoll Jahreszahlen steht für Untergang, Abgründe aber auch den Aufbruch im 20. Jahrhundert. Eine Ära, die als intensiv gilt. 1923 scheint in diesem Reigen auf den ersten Blick wenig mehr als eine kurze Spanne im Windschatten der Großereignisse wie Krieg oder dem Fall des Eisernen Vorhangs. Zu Unrecht wie das Buch „Deutschland 1923 – Das Jahr am Abgrund“ von Volker Ullrich belegt. Zwölf Monate, die weit mehr als ein Intermezzo zwischen dem Untergang des Kaiserreichs mit seiner Klassengesellschaft und der Machtübernahme der Faschisten, die zu Weltkrieg und Holocaust führte. Die Wucht der Brüche und Verwerfungen in 1923 wirkt aus der Retroperspektive wie ein Turbo auf dem Weg vom Stände- zum Führerstaat. „Eine Tollhauszeit in riesigen Proportionen“, wie der Dichter Stefan Zweig das Krisenjahr nannte.
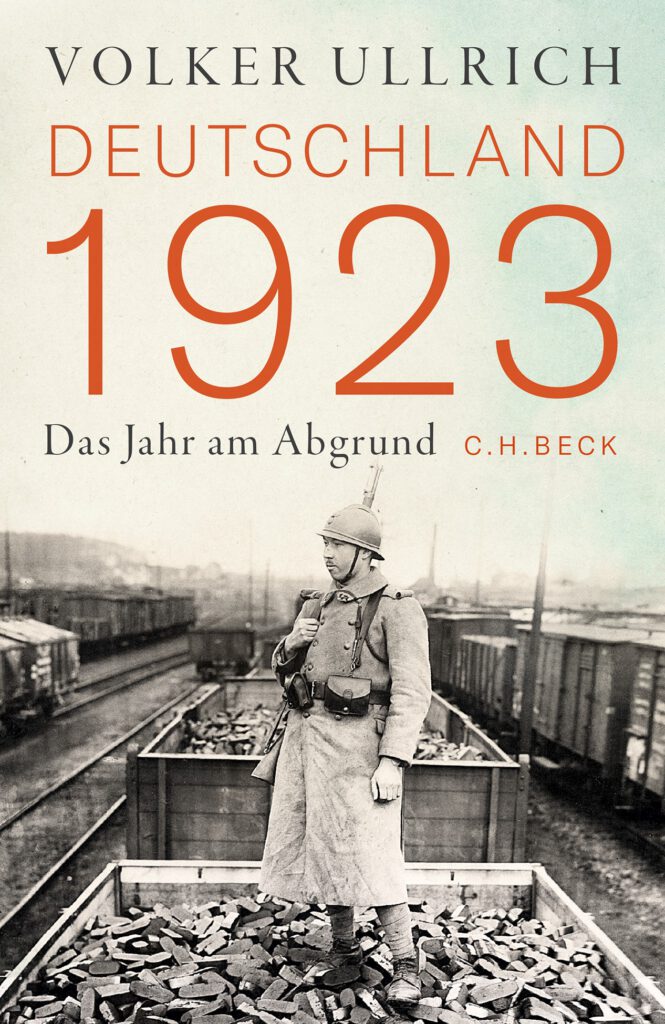
Deutschland 1923
Das Jahr am Abgrund
C.H. Beck Verlag, München 2022
Gebunden, 441 Seiten, 28,00 EUR ISBN 9783406791031
Die Gleichzeitigkeit der Abläufe mutet heute noch surreal an: Der Hitler – Ludendorff Putsch, ein gewaltsamer Umsturzversuch im November 1923, Straßenschlachten zwischen der extremen Linken und Rechten mit vielen Toten, der von Moskau geplante „Sturm auf die Republik“ der KPD, die fatale Besetzung des Ruhrgebiets durch französische Truppen, um ausstehende Reparationszahlungen einzutreiben, ein monatelanger Generalstreik an der Ruhr, Separationsbestrebungen in Bayern, im Westen und der beschaulichen Pfalz: Ullrich versteht es in seiner Publikation die ineinander verwobenen Ereignisse verständlich einzuordnen und das Gewirr von Ursache und Wirkung in einer tief gespaltenen Gesellschaft zu entflechten. Quelle für all diese Verwerfungen war der verlorene Krieg, eine Niederlage, die das Militär und der Konservative Teil der Gesellschaft nicht bereit war, zu akzeptieren. Stichwort: Dolchstoßlegende.
Heute noch wundern sich Länder wie Italien, Frankreich oder Griechenland vor der panischen Angst der Deutschen vor Inflation. Diese Furcht vor Geldentwertung, die fest in der DNA unseres Volkes verankert scheint, wurde von der Hyperinflation im Sommer und Herbst 1923 ausgelöst. Die Folge einer Kriegswirtschaft, die glaubte all die Schulden für Kanonen und Gewehre nach dem Sieg mit den reichlich zu erwartenden Reparationszahlungen aus der Portokasse begleichen zu können. Nach der Niederlage musste stattdessen Deutschland für die Kriegsschäden in Frankreich oder England bluten. Als die Zahlungen ausblieben, annektierte Frankreich -auf lange Sicht wenig durchdacht- das Ruhrgebiet. Die Folge: die Geldentwertung wurde zusätzlich befeuert.

Die Lektüre von Ullrichs „Deutschland 1923“ wird wie ein deja vu bei vielen Lesern Erinnerungen aus dem kollektiven Familiengedächtnis freikratzen. Die Großmutter, die im Schlafzimmerschrank hinter der schweren Aussteuer-Bettwäsche Bündel von Geldscheinen wie Briketts stapelte. Links die Hunderter aus der Vorkriegszeit, ganz Rechts die Noten aus dem November 1923 mit dem Billionen-Aufdruck und quasi als Zugabe ein Regal tiefer die entwertete Reichsmark von 1948. Oder die Großtante, die 1915 Gold gegen Anleihen tauschte, die im Jahr 1923 allenfalls zum Holzanzünden taugten und heute eine preiswerte Deko für jeden Partykeller sind. Beide hofften noch Jahrzehnte später auf einen Ausgleich für ihr verlorenes Vermögen.
Die Demokratie in Deutschland überlebte das in Friedenszeiten einzigartige Krisenjahr 1923, auch weil an der Spitze mit Stresemann und Ebert leidenschaftliche Verfechter der neuen Staatsordnung standen, die trotz vieler egoistischer parteipolitischer Ränkespiele -auch in der Mitte des Reichstags- Kurs hielten. Dennoch: Mit ihrem Vermögen verloren Millionen Menschen das Vertrauen in die Demokratie. Ein Manko, das Hitler ermöglichte während der Weltwirtschaftskrise (1929 bis 1933) mit der Billigung eines großen Teils der Bevölkerung, deren moralische Widerstandskraft erschöpft war, eine Diktatur zu etablieren.
Ullrich belegt sehr detailliert wie der Staat sich 1923 davor scheute, Umtrieben von rechts entschieden zu begegnen. Den missglückten Hitler-Ludendorff-Putsch betrachteten konservative Kreise und das Militär als Kavaliersdelikt. Als Bayern eine Art Diktatur im Freistaat errichtete und den Landtag ausschaltete, reagierte Berlin nicht mit Sanktionen, marschierte aber mit Truppen in Sachsen und Thüringen ein als hier die SPD und die KPD eine Art Volksfront im Landtag vereinbarten. Dieser Einmarsch lieferte für die spätere Ausschaltung von Preußen die Blaupause, die machtstrategisch die Kanzlerschaft Hitlers beförderte. Die grobe Ungleichbehandlung Bayerns und Sachsens war -gegen den Widerstand von Reichspräsident Ebert- der Grund für das Ausscheiden der SPD aus der Koalition der Mitte. Ein ebenso ehrenhafter wie umstrittener Schritt, denn er bedeutete für die Sozialdemokraten eine lange Zeit des Abschieds von den politischen Gestaltungsmöglichkeiten. 1923 war aber auch eine Zeit der Diffamierung von politischen Institutionen und Akteuren durch die Rechtspresse. Die Parallelen zu heute, zu 2023 sind unübersehbar und beängstigend. Verteidiger der Demokratie wie Ebert und Stresemann rieben sich in diesem Klima von Fake News und Unterstellungen auf. Ihren Nachfolgern fehlte das demokratische Standing.
Mit „1923- Das Jahr am Abgrund“ bringt Volker Ullrich Ordnung in zwölf turbulente Monate, in denen es an allen Ecken gleichzeitig brodelte. Der Autor entwirft ein verständliches Zeit-Panorama, das den Leser in die Lage versetzt, scheinbar zusammenhanglose Ereignisse einzuordnen. Zwei Ansätze der Abhandlung verdienen besondere Erwähnung. Ullrich untermauert seine Analyse mit einer Fülle von Zitaten von Zeitzeugen, vom Politiker über den Künstler bis zu den „Menschen auf der Straße“. Deren Beobachtungen aus dem Augenblick lassen Motive von Handlungen oder Situationsbeschreibungen aus dem Wissen der Zeit und nicht aus der Retrospektive postoperativer Klugheit begreifen. 1923 war aber auch ein Jahr des kulturellen und technologischen Aufbruchs, eine Zeit der Avantgarde, die zumindest in Berlin das gesellschaftliche Leben mitprägte. Volker Ullrich, seit 1990 Leiter des Ressorts „Politisches Buch“ bei der Wochenzeitung „Die Zeit“, spürt diesen gesellschaftlichen Hintergründen und Verknüpfungen nach, die politisches Handeln beeinflussen.
„Kein Volk der Welt hat erlebt, was dem deutschen 1923-Erlebnis entspricht“, schrieb der Journalist Sebastian Haffner im englischen Exil. Volker Ullrichs Schilderung der Abläufe ist weit mehr als eine Chronik. Es hilft eine Zeit zu verstehen. Es ist aber indirekt eine Warnung, denn die Geschichte dieses Jahrs am Abgrund erinnert in mancher Passage unheilvoll an die Gegenwart.
Matthias Müller
Suche nach Auswegen aus der Krise liberalen Denkens
Hat der Liberalismus noch Antworten auf die drängenden Fragen der Zeit oder kann er´s nicht? Muss man den Liberalismus dafür „neu denken“ oder wird er einfach unter Wert gehandelt und schlecht umgesetzt? Unbestreitbar ist er ernsthaft herausgefordert, auf globaler Ebene durch autoritäre und keineswegs erfolglose Entwicklungsmodelle, siehe China. In Europa durch „illiberale“ Demokratien, siehe Ungarn und Polen. In Deutschland selbst durch linke und rechte Identitätspolitik sowie eine neue Lust an staatlichen Interventionen. Ralf Fücks und Rainald Manthe vom „Zentrum liberale Moderne“ haben nun mit Förderung der Zeit-Stiftung und der Friede-Springer-Stiftung einen Band herausgegeben, in dem ein breites Spektrum von teilweise recht prominenten Autoren versucht, die Frage zur Zukunft des Liberalismus zu beantworten.
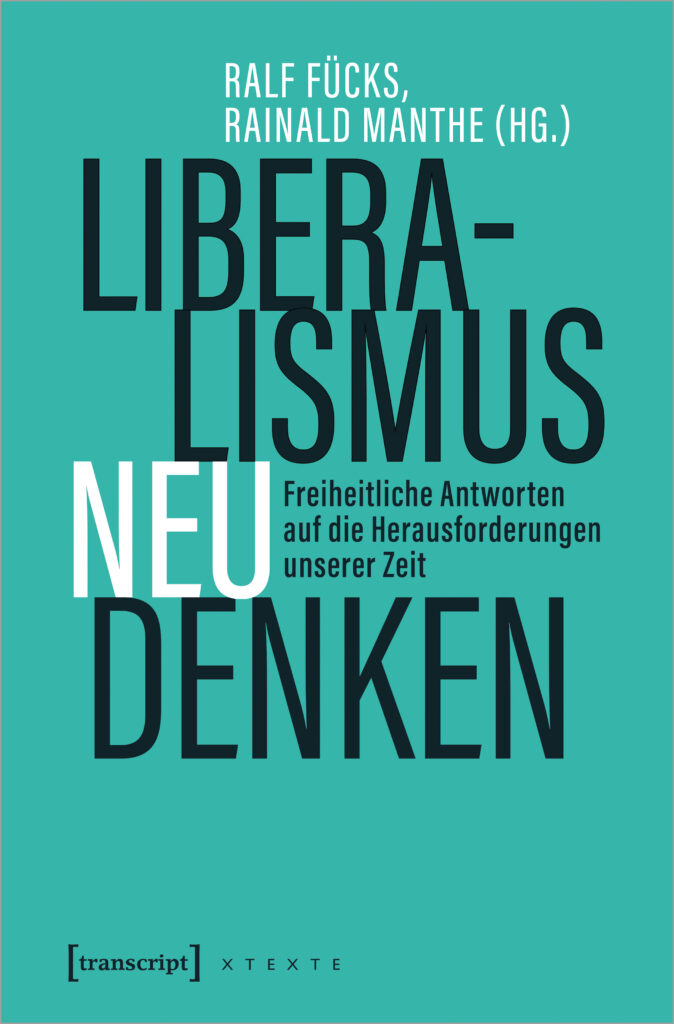
Liberalismus neu denken
Freiheitliche Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit
Transcript Verlag, 202 Seiten 19,50 €
ISBN: 978-3-8376-6319-8
Die gegenwärtige Krise des Liberalismus hängt, so lernt man, auch damit zusammen, dass man ihn lange überschätzt und allzu sehr darauf vertraut hat, dass er durch sich selbst überzeugt und ausreichende Bindungskräfte an eine freiheitliche Ordnung erzeugt. Demokratie und Freiheit sind keineswegs einfach zwei Seiten einer Medaille, wie Rainer Hank in seinem Beitrag zeigt. Auch in der Demokratie müsse die Freiheit immer wieder verteidigt werden. Die Globalisierung hat in den Gesellschaften weltweit machtvolle Gegenkräfte zur liberalen Ordnung erzeugt, so die These von Michael Zürn. Die Begleiterscheinungen der Globalisierung, Öffnung der Märkte, neue Konkurrenz, nicht zuletzt aber auch Migration und die Zunahme der Vielfalt von Kulturen, Lebensstilen und Identitäten haben, Zürn zufolge, der liberalen Demokratie „innere Gegner“ geschaffen, gegen die die liberale Demokratie bisher noch keine wirksamen Mittel gefunden habe.
Besonders deutlich wird dieser Aufstand gegen die liberale Ordnung in Ostmitteleuropa, dem Jaques Rupnik nachgeht. Hier habe man von liberaler Seite lange Zeit die soziale Frage vernachlässigt, was sich rechte Populisten zunutze machten. Ebenso habe man die Gesellschaften dieser Länder mit einem zu schnellen kulturellen Wandel überfordert, was zum Widererstarken der nationalistischen Identitätspolitik und einer „Regression der Demokratie“ in Richtung Illiberalität dort beigetragen habe.
Die Frage der Ungleichheit wurde von Liberalen lange Zeit zu sehr auf die leichte Schulter genommen. Christoph Möllers weist darauf hin, dass Ungleichheit selbst ein freiheitgefährdendes Potential aufweise und ein Individualismus ohne eine soziale Dimension seine eigenen Grundlagen gefährdet. Deshalb brauche es so etwas wie eine „liberale Kapitalismuskritik“.
Jan-Werner Müller, Professor an der Princeton-Universität, warnt allerdings davor in den, in Deutschland besonders lauten, „kommunitaristisch-kitschigen Chor“ einzufallen, nachdem „Demokratie primär Zusammenhalt bedeute“. Eine erfrischende These, die den neu gedachten Liberalismus vielleicht vor seinem nächsten großen Irrtum bewahren kann, nämlich den, man könne die Spannung, die nun mal zwischen Freiheit und Gleichheit angelegt ist, durch das Beschwören von Zusammenhalt und sozialem Ausgleich einfach aufheben.
Ein neu gedachter Liberalismus muss sich allererst aus dem Salon der kosmopolitisch-aufgeklärten, materiell bestens abgesicherten Eliten in die rauhe Wirklichkeit der Gesellschaft begeben, wenn er denn für sich eine wirklich ernsthafte Perspektive beanspruchen will. Dort wird man auf harte Kontroversen stoßen, etwa zur Migration. Es mag humanitäre Argumente für offene Grenzen für Flüchtende, es mag auch viele wirtschaftliche Argumente für den Zuzug von Arbeitskräften geben, man muss sich aber klar sein, dass man sich dadurch auch auf Konflikte stößt, nicht nur Verteilungskonflikte bei Arbeitsplätzen und Wohnungen, sondern auch kulturelle Konflikte. Cornelia Schu zitiert in ihrem Beitrag Befunde aus Untersuchungen des Sachverständigenrats für Migration, dass die Bevölkerung eine zunehmende kulturelle Diversität der Gesellschaft akzeptiert, aber gesichert haben will, dass Zuwandernde hier etwas leisten, also Arbeit aufnehmen, für sich selbst sorgen und sich ein Stück weit auch anpassen. Bedingungslose Zuwanderung findet offenkundig keine Zustimmung. Hilfreicher als ein überstrapazierter Zusammenhaltsdiskurs sei hier die Einübung der zivilen Austragung von Konflikten.
Den Nexus zwischen wirtschaftlichen Freiheitsrechten und sozialen und politischen Freiheitsrechten scheinen einige Autoren dem schönen Bild eines sozial geläuterten Liberalismus zuliebe ein wenig in den Hintergrund rücken zu wollen. Wirtschaftliche Themen spielen in dem Band keine zentrale Rolle. Ausnahmen: die Beiträge von Gabriel Felbermayer zum Freihandel, von Achim Wambach zur Wettbewerbspolitik und von Herausgeber Fücks selbst mit einem Plädoyer für die Eigentumsbildung breiterer Schichten. Eigentum war und ist eben auch ein wichtiger Pfeiler einer freiheitlichen Ordnung. Da hat er recht. Ob mit einer „Eigentümergesellschaft“ wirklich eine Alternative zur „Klassengesellschaft“ des Kapitalismus geschaffen werden kann, steht jedoch dahin. Die Forderung der Eigentumsbildung ist ja nicht neu. Nur ist das Ganze nicht ohne Nebenwirkungen zu haben. Dazu wird leider nichts ausgeführt.
Und weil das so ist, ist es auch so schwierig mit dem Ausgleich von sozialen und wirtschaftlichen Freiheitsrechten. Der prominente Eröffnungsbeitrag des in den USA lehrenden Historikers Timothy Garden Ash ist ein Beispiel dafür wie man Widersprüche und Konflikte überspielt. Freiheit, Gleichheit, Solidarität, Globalisierung und nationale Identität – all das möchte er mit einem vermittelnden „Sowohl als auch“ im neu erfundenen Liberalismus des 21. Jahrhunderts versöhnen. En passant plädiert er für ein „bedingungsloses Grundeinkommen“, das er auch ins Paket des neuen Liberalismus packen möchte. Er ist Historiker und kein Ökonom. Wäre er dies, hätte er vielleicht eine Ahnung davon, welche gigantische Umverteilung mit erheblichen Eingriffen in Eigentumsrechte so etwas auslösen würde.
Ein Beitrag, der die Widersprüche, Spannungen und Konflikte einer liberalen Ordnung etwas genauer und ehrlicher beleuchtet, hätte dem Band gutgetan. Denn nur damit kann man der Gefahr des Selbstbetrugs entgegen, der den Liberalismus des 20. Jahrhunderts schließlich in der Sackgasse hat enden lassen.
Der Band von Fücks und Manthe bietet trotz einiger Leerstellen einen guten Überblick über liberales Denken heute. Gut für den Leser, dass es diesen Band auch als Open Source kostenlos zum Herunterladen im Internet angeboten wird. Allerdings fehlt in der Open-Source-Ausgabe der Artikel von Timothy Garden Ash.
Matthias Schulze-Böing
Wer versteht noch die Welt?
Konflikte und Komplexität überfordern unsere Institutionen und Politiker. Die Welt bebt, überall kommt es zu Kontrollverlusten. Die Regierungen verlieren die Kontrolle über ihre Grenzen, die Banken die Konkrolle über ihre Bilanzen, und nicht wenige Wirtschaftsführer verlieren Maß und Mitte. Ein aggressiver Finanzkapitalismus zehrt die Wirtschaft aus, die tragende Mitte unserer Gesellschaft wird immer weiter ausgehöhlt. Zudem scheinen Digitalisierung und Globalisierung uns zu überfordern. Warum wir trotzdem nicht verzweifeln müssen und wie wir im Zeitalter der Überforderung gut leben können, zeigt Gabor Steingart, der Herausgeber des „Handelsblatts“ und ehemalige „Spiegel“-Büroleiter in Berlin und Washington in seinem Buch „Weltbeben“. Steingart analysiert wie gewohnt schonungslos und schürt zugleich Hoffnung auf eine Zukunft, die wieder Zuversicht verdient: „Das Gebot der Stunde heißt Dialog, auch Streit, nicht Zurückweisung oder Ausgrenzung. Es geht um das Verwandeln von Angst in Hoffnung, von Verunsicherung in Zuversicht. Nur wer die Überforderung begreift, kann sie überwinden.“
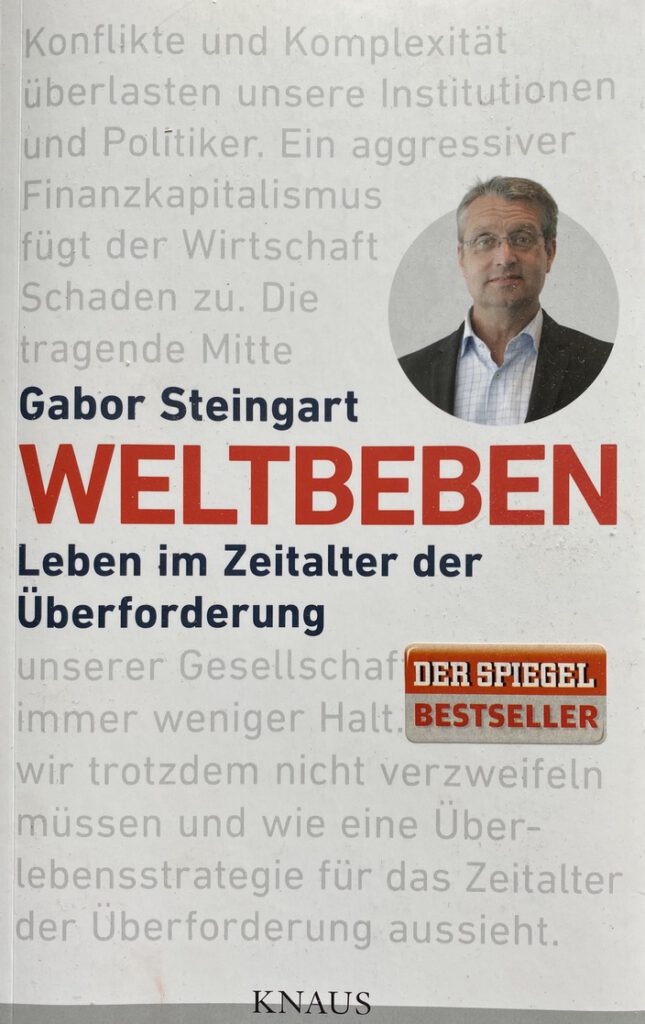
Weltbeben: Leben im Zeitalter der Überforderung
Gabor Steingart, Paperback,
236 Seiten, Verlag Knaus, 16,99 Euro,
ISBN: 9783813505191
In der weiteren Demokratisierung der Demokratie sieht Steingart die Antwort auf das große Weltbeben. Für ihn besinnt sich das Bürgertum in der Ablehnung des Establishments wieder seiner Stärken, giert nach Selbstbestimmung. Die Wucht des bevorstehenden Umbruchs werde unterschätzt, meint Steingart und macht zugleich neugierig: „Die Revolte hat keinen Namen, nur viele Gesichter, sie besitzt ein gesellschaftliches Hinterland, aber keine Adresse. Es gibt so viele, aber nicht den einen, den man mit Aussicht auf Verhaltensänderung einschüchtern, abhören, einkerkern, umschmeicheln oder bestechen könnte. Wir erleben eine Revolution ohne Revolutionäre, einen Umbruch ohne Bruch, der sich mit schöner Selbstverständlichkeit tarnt.“
Auch wenn das Buch schon älter ist: Steingart schreibt Klartext, der auch in die heutige Zeit der zusätzlichen Verunsicherung durch den Vernichtungskrieg in der Ukraine passt.
Frank Pröse
Irrwege der Politik des Westens
Als der amerikanische Historiker Francis Fukuyama 1989 in einem Zeitschriftenaufsatz das „Ende der Geschichte“ ausrief und einen weltweiten Sieg des westlichen demokratischen und marktwirtschaftlichen Gesellschaftssystems vorhersagte, war das für viele eine kühne, aber nicht ganz unplausible Situationseinschätzung. Der Zusammenbruch der Sowjetunion hatte die Dysfunktionalität des sozialistischen Gesellschaftsmodells offenbar gemacht, in den Staaten des früheren Ostblocks gab es demokratische Revolutionen, China begann mit der Öffnung in Richtung Marktwirtschaft und viele erwarteten, dass sich damit dort langfristig auch liberale und demokratische Ideen durchsetzen.
Heute, mehr als dreißig Jahre später, zeigt sich ein ganz anderes Bild. Der Überfall Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022 hat die Hoffnungen zerstört, durch die Einbindung des Landes in Handelsbeziehungen dessen imperiale Ansprüche zu bändigen und innerhalb des Landes demokratische Entwicklungen zu stärken. Die kommunistische Parteiherrschaft in China zeigt sich nach innen immer autoritärer und nach außen zunehmend aggressiv. Die in den „arabischen Frühling“ gesetzten Hoffnungen sind zerstoben. Der Versuch, in Afghanistan mit Milliarden an finanziellen Hilfsmitteln und militärischer Intervention einen demokratischen Staat und eine funktionierende Zivilgesellschaft nach westlichem Vorbild aufzubauen endeten in einem Desaster. Antiwestliche Sentiments verstärken sich in vielen Teilen der Welt, nicht immer, aber sehr oft befeuert von autoritären Diktaturen und Gewaltherrschern.
Susanne Schröter, Leiterin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam und Professorin an der Goethe-Universität, sieht zwei Ursachen für das „globale Scheitern“ des Westens: eine aus Ignoranz und Arroganz gespeiste Hybris einer vermeintlichen Überlegenheit des westlichen Gesellschaftsmodells auf der einen Seite und einen damit in paradoxer Weise gepaarten Selbsthass der westlichen Gesellschaft auf der anderen, der sich nicht nur im Antikapitalismus der traditionellen Linken, sondern auch in den modischen und teilweise recht kruden Ideologien von „Postkolonialismus“, „Critical Race Theory“ und Genderaktivismus Ausdruck gibt. Der Westen sei seiner Sache viel zu sicher und gebe gleichzeitig seine Werte und Errungenschaften ohne Not preis, mahnt Schröter.
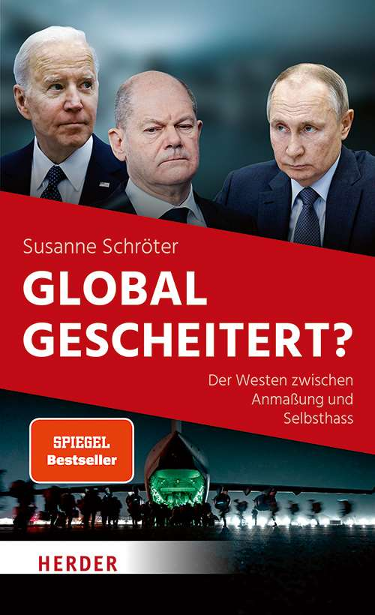
Global gescheitert? Der Westen zwischen Anmaßung und Selbsthass
Susanne Schröter, Klappenbroschur,
240 Seiten, Verlag Herder, 20 Euro,
ISBN: 978-3-451-39367-9
Auf rund 200 sehr klar und verständlich, ohne soziologischen Begriffsschwulst geschriebenen Seiten schlägt Schröters Zeitdiagnose einen sehr großen Bogen von den Schauplätzen weltpolitischer Konflikte zu den identitätspolitischen und kulturellen Kampfplätzen an Universitäten, in Institutionen und Mittelschichtmilieus westlicher Gesellschaften. Es ist ein für ein so umfassendes Thema sehr kompakter Band, der aber in aller Knappheit, in der die jeweils für sich sehr komplexen Probleme abgehandelt werden, doch viele Informationen und kluge Einblicke versammelt.
Am Beispiel des westlichen Scheiterns in Afghanistan zeigt Schröter, mit welch naiven Vorstellungen der Westen meinte, eine tief in archaischen Stammesstrukturen verwurzelte Gesellschaft in kurzer Zeit zu westlichen Standards von Liberalität und Demokratie führen zu können. Hier sei die westliche Allianz von NATO-Staaten einfach eigenen Wunschvorstellungen aufgesessen, habe es versäumt, die eigenen Prämissen kritisch zu hinterfragen und sich ernsthaft mit der Kultur des Landes und seinen Machtstrukturen zu beschäftigen. Im Ergebnis habe man nicht nur eine schmähliche, von der ganzen Welt beobachtete politische und militärische Niederlage erlebt, sondern habe während der über zwanzig Jahre währenden Kampagne eine durch und durch korrupte Gesellschaft genährt, die sich schließlich widerstandslos den Taliban ergeben hat. Wenn man sich nur etwas näher mit der Machtlogik einer patriarchalischen Stammesgesellschaft wie in Afghanistan beschäftigt hätte, hätte man nach Auffassung Schröters von Anfang an zu einer realistischeren Einschätzung der Möglichkeit der Durchsetzung westlicher Standards bei Geschlechterrollen, Bildung, Zivilgesellschaft und staatlicher Verwaltung kommen können. So aber habe man sich von ein paar Vorzeigeprojekten und dem oberflächlichen Eindruck von gesellschaftlicher Modernisierung in den wenigen städtischen Zentren blenden lassen und sei schließlich an der Realität gescheitert.
Einen Mangel an Realismus sieht Schröter auch beim Umgang mit dem Islam. In knapper, aber präziser Form gibt sie einen Abriss des Aufstiegs des Islam, seiner Rückschläge und den Quellen der wirkmächtigen Narrative der Muslime als Opfer von Kolonialismus und Unterdrückung. Der moderne politische Islam hatte stets vielfältige Erscheinungsformen. Einig war man sich dort aber immer in der Ablehnung westlicher Werte, hinter denen man kolonialistische oder imperialistische Unterwerfungsstrategien zu erkennen meinte.
Genau darin besteht die ideologische Brücke zur westlichen Linken. Der Aufstieg des Ajatollah Khomeini wurde maßgeblich von linken Intellektuellen wie Michel Foucault gefördert, die islamische Revolution im Iran bei den westlichen Linken durchweg begrüßt. Man übersah die fundamentalistischen Motive und den absoluten Herrschaftsanspruch Khomeinis gerne, weil der von den Islamisten gebrandmarkte „große Satan“ USA doch auch in der eigenen Ideologie als Ursache fast aller Weltübel angesehen wurde. Ähnlich verfuhr man bei islamistischen Bewegungen in anderen Weltteilen. Das islamistische Opfernarrativ und das linke Opfernarrativ ergänzten sich immer wieder bestens. Dass man damit genuin linke Werte wie Gleichberechtigung und Emanzipation immer wieder massiv konterkarierte, gehört für Schröter zur Schizophrenie der Linken, die sich auch im Umgang mit dem sogenannten „realen Sozialismus“ oder mit autoritären Regimen in der dritten Welt zeigt. Die Ablehnung der USA und des von ihr verkörperten kapitalistischen Gesellschaftssystems wiegt in aller Regel schwerer als Menschenrechte, liberale Werte oder nur eine genauere Betrachtung der tatsächlichen sozialen Lebensverhältnisse in den Ländern, mit denen man sich solidarisch erklärt.
Instruktiv sind auch die Kapitel zum Umgang mit dem Islamismus in dem Band. Auch der kranke daran, dass man sich kritiklos dem Opfernarrativ anschließt, das vor allem von den organisierten Vertretern des Islam immer wieder reproduziert wird. Kritik an den rückwärtsgewandten Vorstellungen und Werten unter den Muslimen werde nicht nur von den Islamverbänden, sondern auch von sich links gebenden Politikern, Wissenschaftlern und Medienschaffenden schnell mit dem Vorwurf der „Islamophobie“, wenn nicht gar des „antimuslimischen Rassismus“ gekontert. Damit verfehle man nicht nur die Sache selbst, sondern falle auch all denen in den Rücken, die sich für eine Modernisierung und Liberalisierung des Islam einsetzen. Es ist Schröter zuzustimmen, dass eine realistische und ehrliche Bestandsaufnahme der bestehenden Probleme wesentlich mehr zur Integration und zum wechselseitigen Verständnis von Muslimen und Nicht-Muslimen beiträgt als Beschönigungen und Tabus. Wunschdenken führt auch in der Migrations- und Integrationspolitik in die falsche Richtung. Notwendig scheint vielmehr eine selbstbewusste Verteidigung der Werte und Normen einer liberalen Gesellschaft.
Sehr instruktiv sind die Kapitel zu den Varianten der neuen linken Identitätspolitik und deren Hintergrundtheorien wie die sogenannte „postkolonialistische“ Theorie und die vor allem in den USA mit den „Black-Lives-Matter“-Bewegung bekannt und prominent gewordene „Critical Race Theory“. Beide sind, so scheint es, mehr Ideologie als Wissenschaft. Auf jeden Fall stehen sie auf sehr wackeligen Grundlagen, was Schröter am Beispiel des einflussreichen „Postkolonialismus“-Theoretikers Edward Saïd zeigt. Was diese Theorien eint, ist der anti-westliche Duktus, zugleich aber ihr großer Einfluss auf mediale Diskurse und ihre hohe Mobilisierungskraft. Ähnlich wie die pseudowissenschaftlichen „Gender“-Theorien haben sie ihren Siegeszug in den geisteswissenschaftlichen Fakultäten amerikanischer Eliteuniversitäten begonnen, haben aber auch in Europa und anderen Teilen der Welt inzwischen großen Einfluss. Die „Critical Race Theory“ erweise sich, so Schröter, bei näherer Betrachtung als so etwas wie ein umgedrehter Rassismus, der den Weißen eine nicht zu löschende Schuld an allen historischen Missetaten der wirklichen Rassisten zuschiebt, so etwas wie eine Erbsünde des Weißseins. Ein solche Auffassung wäre harmlos, bliebe sie eine der ja nicht so wenigen Skurrilitäten im Denken einer abgehobenen Schicht von Akademikern und Intellektuellen. Hochproblematisch ist allerdings, wenn sich diese Theorien, wie geschehen, Alleinvertretungsansprüche für bestimmte Themen anmaßen und neue Formen der Intoleranz befeuern, etwa der Cancel-Culture in Universitäten, Medien und der Öffentlichkeit. Auch die Nähe der Postkolonialismus-Theorie zu antisemitischen Positionen und zur Relativierung des Holocaust sollte eigentlich skeptisch stimmen.
Identitätspolitik ist, folgt man Schröter, inzwischen nicht nur eine ideologische Verirrung, sondern ein regelrechtes Geschäftsmodell. Mit ihr werden Quotierungen bei der Vergabe von gutbezahlten Stellen im öffentlichen Dienst begründet. Eine Vielzahl von Instituten und Bildungseinrichtungen lebt inzwischen von der üppigen Förderung identitätspolitischer Themen. Identitätspolitisch instruierte Absolventen geisteswissenschaftlicher Studiengänge haben Einfluss in Medien, Kommunalparlamenten und Verbänden und treiben von dort aus die Verbreitung ihrer Deutungsmuster voran. Eine regelrechte Diversitätsindustrie von Beauftragten, Trainern, Handbuchautoren und Projektemachern lebt inzwischen recht gut von diesem Trend.
Susanne Schröter negiert die vielfältigen Probleme westlicher Gesellschaften mit Ungleichheit, Diskriminierung und auch Rassismus keineswegs. Sie weist allerdings deutlich darauf hin, dass man diese Probleme nicht lösen kann, wenn man sie als Legitimation für einen fundamentalen Selbsthass der freiheitlichen Gesellschaft missbraucht und damit letzten Endes das Geschäft all derer betreibt, denen Aufklärung und Liberalität selbst Dorne im Auge sind.
Was man in dem bei den vielen Reizthemen durchaus produktiv zuspitzenden Buch etwas vermisst, sind Erklärungen für das Doppelphänomen von Hybris und Selbsthass. Warum hat der Selbsthass Konjunktur? Warum sind Postkolonialimus-, Critical-Race- und Gendertheorien im öffentlichen Diskurs so anschlussfähig? Warum gelingt es so leicht, kritische Stimmen dazu in die „rechte“ Ecke und diskursive Tabuzonen zu drängen? Warum gibt es die „doppelte Selbstüberschätzung“ des Westens, der sich gleichzeitig die Macht zum Bösen in Form von Rassismus und Kolonialismus und die Macht zum Guten der Demokratisierung und Liberalisierung der ganzen Welt zumisst?
Und natürlich fragt sich der politisch interessierte Leser, wie die Alternativen zur kritisierten Politik des Westens in Afghanistan und in anderen Ländern aussehen könnten. Dazu schweigt die Autorin. Hätte man Afghanistan sich selbst überlassen sollen? Soll man vor der Verletzung von universell geltenden Menschenrechten in archaischen Kulturen die Augen verschließen? Wäre das Realpolitik?
Noch ist nicht klar, wie eine realistische Politik aussehen könnte, die nicht in Hybris verfällt, aber dennoch den universalistischen Anspruch von Aufklärung und Menschenrechten nicht aufgibt. Klarer scheint allerdings, wie mit den Ideologien des Selbsthasses der westlichen Gesellschaft umzugehen ist. Man muss sie kritisieren. Ideologiekritik war einmal die Meisterdisziplin der aufgeklärten Linken. Zeit, mal wieder darüber nachzudenken. Gelegentlich hilft dabei ein gutes Buch.
Matthias Schulze-Böing
Raubzug im Namen von Corona
Nach der Corona-Welle ist vor der Corona-Welle: Und das bedeutet in der Regel nichts Gutes. So fragt es sich aus gutem Grund, ob Virologen und Epidemiologen sich bei ihrem Kampf gegen die Pandemie irgendwann einmal auf mehr als rudimentäre, willkürlich ermittelte und politisch lancierte Daten stützen können. Denn während der Pandemie ist doch deutlich geworden, dass interessengeleitete Politik im Feld der Zahlen ein dankbares Instrument zur Legitimation des eigenen Handelns errichten kann. Ein Beispiel: Zeigt sich der politische Erfolg an der Impfquote? Oder zählen wir lieben die Gesunden, die Genesenen oder gar die Immunen?
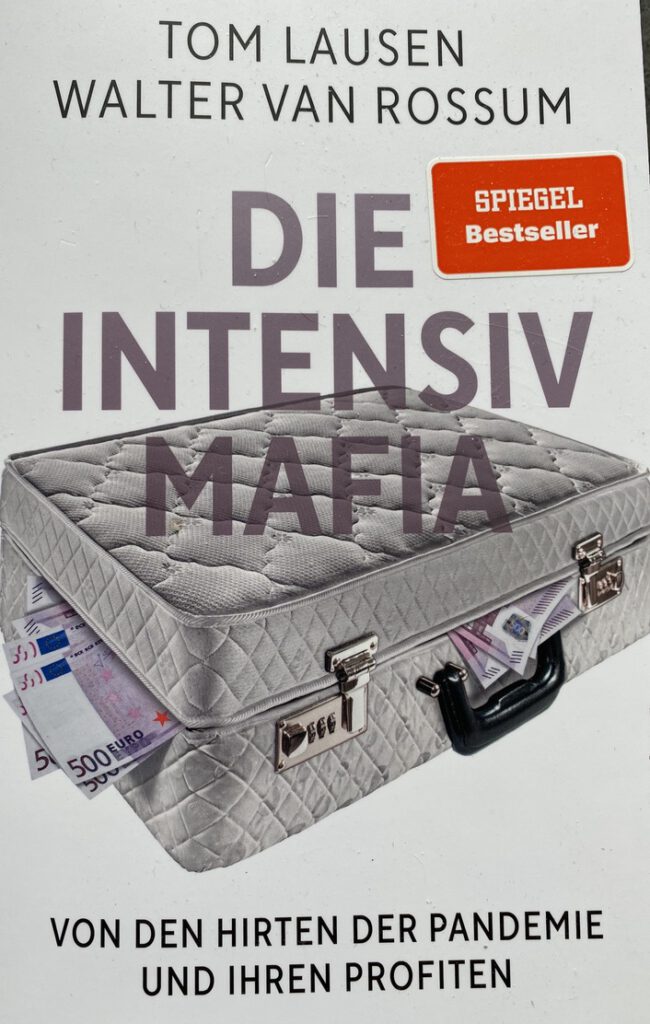
Die Intensivmafia
Tom Lausen und Walter von Rossum,
223 Seiten, Verlag Rubikon, 18 Euro,
ISBN-13:9783967890266
Es fragt sich aber auch, ob Politikbetrieb und Gesundheitsindustrie vor der nächsten Pandemie an einer nochmaligen Veruntreuung und Umverteilung von Abermilliarden Euro gehindert werden können. Im Umfeld von Corona war die Versuchung jedenfalls groß und waren die Sicherheitsmaßnahmen unzureichend. Zu einer wirksamen Vorbeugung gehören Transparenz und die Aufarbeitung von. Korruption und Schlamperei. Wie der Raubzug gegen Bürger, Gesundheitsvorsorge und Volksvermögen unter vonstatten ging, darüber versuchen Tom Lausen und Walter von Rossum in ihrem Buch „Die Intensivmafia – Von den Hirten der Pandemie und ihren Profiten“ aufzuklären. Sie enthüllen schier unglaubliche Fakten über einen epochalen Korruptionsskandal, zu dessen Profiteuren neben Masken vertreibenden Politikern und betrügerischen Impfcenter-Managern auch Ärzte, Klinikleitungen, Krankhausbetreiber , Intensivmediziner, Geräteaufsteller, Medizinverbände, Militär, Gesundheitsministerium und Robert-Koch-Institut zählen. Die Autoren machen auch an penibel dokumentierten Beispielen wie den „Bettenschwundprämien“ deutlich, welche Webfehler in den Gesetzen zum Abkassieren regelrecht einluden und zudem das System noch unbeabsichtigt schwächten. Und jenseits von Corona liefern Informatiker Tom Laus und Walter von Rossum noch Hinweise, dass Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen „kein Skandal ist, sondern Routine“. Wenn das kein Skandal ist.
Frank Pröse
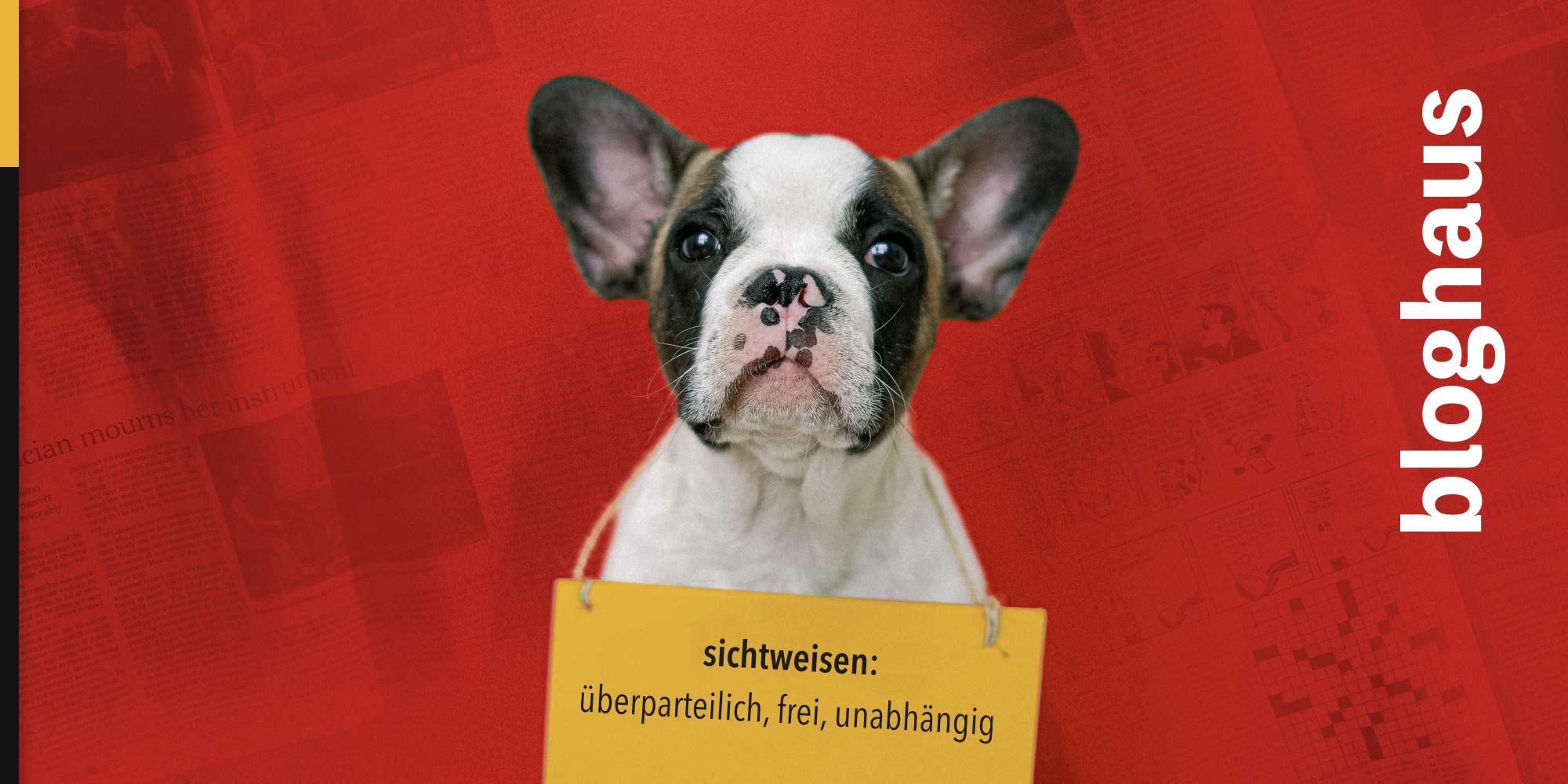
Ein guter Überblick über die jüngst erschienen politischen Bücher!
Zur Wissenschaftskritik: Schon Popper hat immer wieder betont, dass die Wissenschaft keinen absoluten Anspruch haben kann. Nur durch Empirie verbessert die Wissenschaft immer wieder neu ihre Kenntnisse and validiert diese, auch wenn Einsteins seine Relativitätstheorie auf rein theoretischer Basis entwickelt hat. Daher sollte die Politik sicherlich die jeweils besten Kenntnisse der Wissenschaft berücksichtigen und diese in der Entscheidungsfindung einfliessen lassen. Die demokratische Entscheidung kann die Wissenschaft jedoch nicht ersetzen. Das Negieren von wissenschaftlichen Erkenntnissen ist jedoch ebenso schädlich.