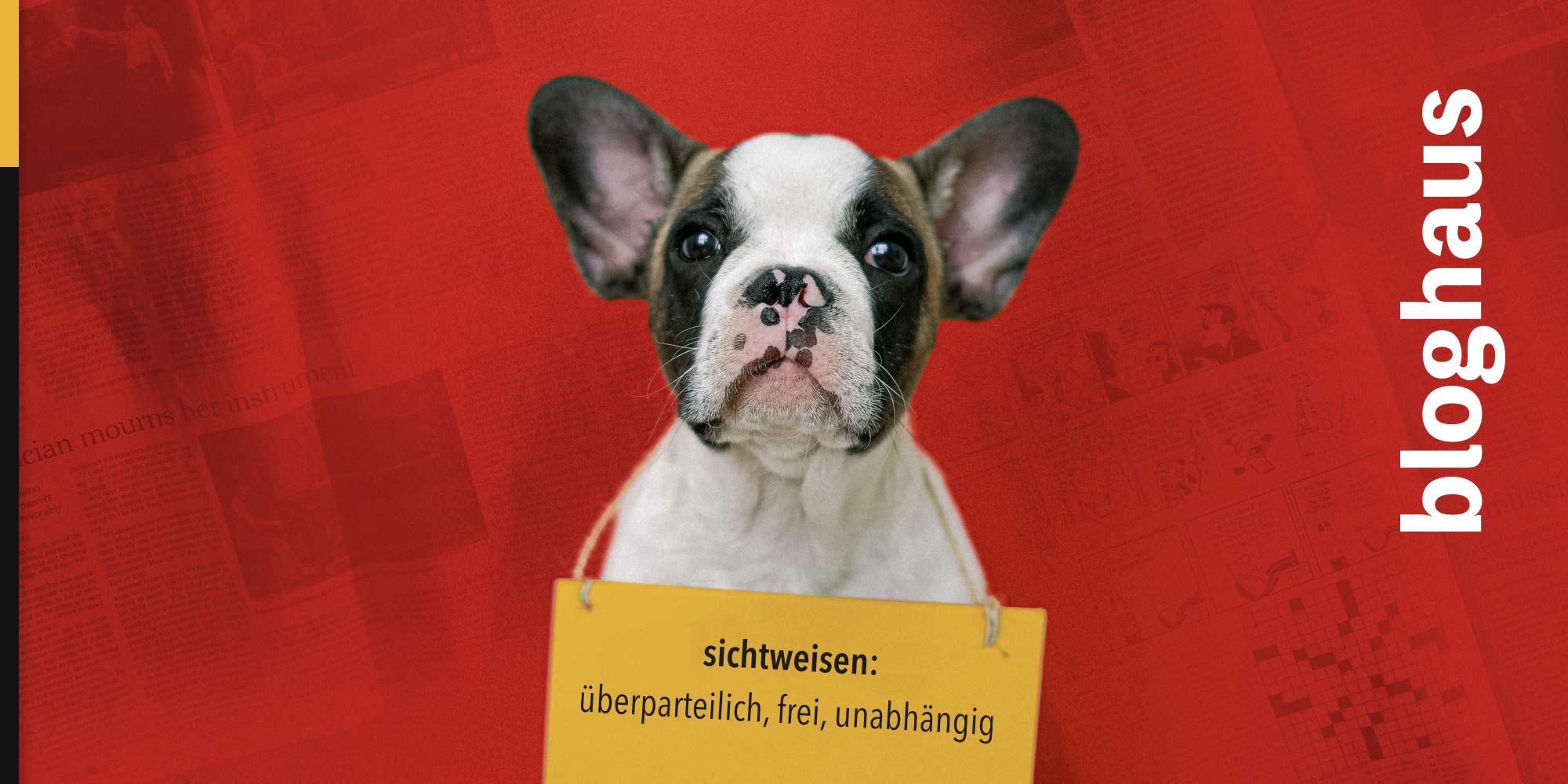– Die Idee einer globalen Sicherheitsarchitektur darf nicht aufgegeben werden –
Mit dem Begriff „Zeitenwende“ umschrieb dereinst Kanzler Olaf Scholz sein politisches Programm als Antwort auf die disruptiven Umwälzungen durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Sein Nachfolger in spe, Friedrich Merz, der außer mit den Kriegsfolgen noch mit dem erratischen Politikstil eines US-Präsidenten Donald Trump zu kämpfen haben wird, versucht mit einem ähnlich markanten Satz die Bevölkerung für seine politische Leitlinie vorzubereiten: „Die Zeiten des Paradieses, wo jeder Wunsch möglich ist, sind vorbei.“ Typisch Merz, möchte man sagen. Aus dem Bauch hinausposaunt. Ohne Sinn und Verstand. Denn erstens können auch in schlechten Zeiten – und die will Merz ja ankündigen – doch wohl Wünsche geäußert werden; sie dürften nur nicht in Erfüllung gehen. Und zweitens tut Merz so, als hätten die Deutschen bisher im Paradies gelebt. Dabei zeugt doch gerade sein mit hunderten Milliarden Euro geschnürtes Schuldenpaket zur Reparatur einer total abgewirtschafteten Infrastruktur von Zuständen, die ja wohl kaum paradiesisch genannt werden können.
Außerdem leben die Deutschen schon seit 2022 wenig paradiesisch nicht an einer Stätte des Friedens, sondern nachbarschaftlich mit der Ukraine und anderen von Wladimir Putin bedrohter Ländern verbunden in einer Art Vorkriegszeit, die von Monat zu Monat mehr Konturen annimmt. Nach Deutschland will jetzt auch Europa „kriegstüchtig“ werden. Zunehmend auch die zivilisierte Welt sucht also ihr Heil mit immer mehr Waffen und Soldaten in die Zukunft hinüberretten zu können. Die Übermacht der sich zumeist undifferenziert äußernden Aufrüstungs-Lobbyisten in Parlamenten und Talk-Shows wirft schnell mal Errungenschaften der Aufklärung und Erkenntnisse der Friedens- und Konfliktforschung über Bord, weil sie an die Formel aus dem Kalten Krieg glauben, wonach nur ein Gleichgewicht des Schreckens die Katastrophe verhindern kann. Da werden die Potenziale von Wehretats, Mannschaftsstärken, Panzerverbänden, Bomberstaffeln, Flugabwehrsystemen, Drohnenschwärmen etc. hüben und drüben gegenübergestellt, selten qualitativ in die Tiefe gehend.
Friedensgebot im Grundgesetz
Der Laie staunt unterdessen ob der mehr oder weniger vermeintlichen Expertisen hin (zumindest) zu einer Art waffentechnischen Parität und vergisst in diesem allgemeinen Rüstungshype die Gretchenfrage: Wo sind die starken Stimmen für die Grundlagen von Friedensgesprächen, für Rüstungskontrolle als erster Stufe von Deeskalation, für vertrauensbildende Maßnahmen, für die Abkehr vom Formelkompromiss zum integrativen Lösungsansatz? Auf politischer Ebene wie in den zumeist alte Vorurteile und Ängste reaktivierenden Talkrunden spielen sie nicht einmal eine Nebenrolle.
Das irritiert erstaunlicherweise viel zu wenige Zeitgenossen jener Generationen, denen seit 1945 das Friedensgebot quasi via Grundgesetz vorgeschrieben wurde und die Zeitzeugen von Städtepartnerschaften, Schüleraustauschen und Sprachprogrammen zum freundschaftlichen gegenseitigen Kennenlernen sind. Sie werden von den Aufrüstungsbefürwortern mit einer Art Alternativlosigkeit konfrontiert, die so wie behauptet nicht existiert und erst durch hunderte von Milliarden Sonderschulden von der Politik alimentiert wird.
Ein Wumms folgt dem anderen, konzeptionell in großen Teilen ins Blaue hinein. Denn wie sehr sich Kriegsführung mit Einführung Künstlicher Intelligenz (KI) geändert hat, lässt sich in der Ukraine studieren. Sollte Rheinmetall nicht lieber mehr Kampfdrohnen und automatisierte Waffen bauen und dafür weniger Panzer? Und wäre es in diesem Zusammenhang und mit Blick auf die Zukunft der netzwerkzentrierten Kriegsführung am Boden und im All nicht sinnvoller, sich um bessere Aufklärung durch europäische Satelliten zu bemühen, weil der bisherige NATO-Dienstleister USA von der Fahne geht?
Nicht ganz ernst gemeint , aber sinnbildlich: Ist nicht zu befürchten, dass die nahezu auf allen Gebieten rückständige Bundeswehr mit dem jetzt zur Verfügung stehenden Geld erst einmal mit Helmen versorgt wird? Die Ampelregierung lässt mit einer ihrer ersten Hilfsadressen 2022 an die Ukraine grüßen. Keine Frage, die Soldaten benötigen einen wirkungsvollen Kopfschutz. Nach den leidvollen Erfahrungen mit der Beschaffung bei der Bundeswehr dürften Helme höchstwahrscheinlich wieder für eine Mannstärke geordert werden, die eine deutsche Armee nie erreichen dürfte, will die Regierung ihre Jugend nicht zum Dienst mit der Waffe zwingen. Denn die jungen Menschen wollen die staatliche Souveränität ihres Landes einer aktuellen Umfragen zufolge nicht persönlich verteidigen.
Auge um Auge, Zahn um Zahn und die Sehnsucht der Regierenden nach einer mit dem Überlebensrisiko verknüpften Wehrhaftigkeit – das ist die Sache dieser jungen Menschen nicht. Vor allem die CDU/CSU würde noch in diesem Jahr am liebsten junge Männer wieder einziehen. Ausgerechnet die Union will eine Generation in die Pflicht nehmen, auf deren Schultern sie doch schon die finanziellen Lasten der wenig nachhaltigen Lebensweise ihrer Vorfahren abgeladen hat. Das muss doch dämpfend wirken auf jegliche patriotische Einstellung. Die Politik sollte sich vielmehr damit befassen, eine schlagkräftige Berufsarmee aufzustellen, deren Soldaten aufgrund ihrer Ausbildung seltener als Kanonenfutter dienen und vor denen ein Kriegstreiber wie Putin sicher auch mehr Respekt hätte.
Europa als Vorbild
Ist ja nur zur Abschreckung, heißt es nach der Devise si vis pacem, para bellum – wer Frieden will, bereite den Krieg vor. An Überlegungen dazu, wie dieses Prinzip gegen Russland anzuwenden ist, herrscht kein Mangel. Man möchte deshalb hinzufügen: Wer Frieden will, könnte vielleicht auch den Frieden vorbereiten: Si vis pacem, para pacem. Ist das nicht erstrebenswerter und dem Stand unserer Zivilisation vor den Irritationen unter anderem durch Ukraine-Krieg und Trump-Wahl angemessener? Krieg ist kein schicksalhaftes Phänomen, so wie Frieden die höheren Anforderungen an die Völker stellt.
Die wenigen Mahner, die rasch in die Schublade der Putin-Freunde sortiert werden, dürfen nicht aufgeben, das Zivile in den Vordergrund zu stellen, nicht das Militärische. Und wer sie als Spinner der Lächerlichkeit preisgibt, sollte sich erstens fragen, wie er mit der Verantwortung umgeht, junge Menschen angesichts KI-gesteuerter Drohnen und Roboter in einen überwiegend aussichtslosen Kampf schicken zu wollen, weil ein Krieg angeblich nicht zu verhindern war. Natürlich stecken jene, die auf Verhandlung und Annäherung setzen, im Dilemma, dass die Konfliktpartei auf der anderen Seite auch zu Gesprächen bereit sein muss. Der gleichen Situation sehen sich aber auch die natürlich ebenso friedliebenden Befürworter der Aufrüstung gegenüber, denn es ist nicht ausgemacht, dass beispielsweise Russland darüber ein zweites Mal in den ökonomischen Kollaps getrieben und zum Einlenken gezwungen werden kann.
Der Pazifismus der 1980er Jahre war wichtig, dieses klare Bekenntnis zur Friedfertigkeit hat zur internationalen Abrüstung einen wichtigen Beitrag geleistet. Aber jetzt braucht es neue Wege. Das Ziel der Friedenssicherung darf dabei nicht aus den Augen verloren werden nur weil die Weltgemeinschaft an dieser Aufgabe immer wieder scheitert. Alle Länder der Welt haben sich einmal versprochen, künftige Generationen vor der Geißel des Krieges zu bewahren, „die zweimal zu unseren Lebzeiten unsagbares Leid über die Menschheit gebracht hat“ (Charta der Vereinten Nationen). Diese Idee ist doch deshalb nicht falsch, weil ein Land in ein anderes einmarschiert, zumal in der aktuellen Diskussion allzuoft ausblendet wird, dass in vielen Ländern schon vor dem 24. Februar 2022 Krieg herrschte und heute noch herrscht. Es gab seit den 1990ern die Balkankriege, die Golfkriege, Afghanistan. Im Grunde genommen gibt es einen andauernden 30- oder 40-jährigen Krieg der Moderne, an dem sich nur die Schauplätze ändern.
Dass wir jetzt so auf die Ukraine schauen, zeigt nur die allgemein gezeigte Gleichgültigkeit gegenüber den Kriegen, die es vorher gegeben hat. Gerade unter diesem Aspekt bröckelt der hehre Anspruch einer von Putin angegriffenen Friedensordnung des Westens; auch weil sich die „regelbasierte Weltordnung“ mit Blick auf Syrien, Gaza, Afghanistan, Mali, Jemen, Kongo, Sudan etc. als Sprechblase entpuppt. Weil sie weder friedlich noch gemeinschaftlich ist, sind Anspruch und Idee einer friedlichen internationalen Gemeinschaft jedoch nicht per se falsch.
Johannes Varwick, Experte für Internationale Beziehungen, plädiert für ein umfassendes Vorgehen: Eine ausbalancierte Sicherheitspolitik bedeute „eine Politik des Interessenausgleichs, der diplomatischen Tugenden, der Verlässlichkeit und der Rüstungskontrolle“, schreibt der Politologe in der Wochenzeitung „der Freitag“. Die Kompassnadel weist dabei auf ein zunehmend transnationales Gerüst, mit dem Demokratie, Meinungsfreiheit, Rechts- und Sozialstaatlichkeit verteidigt werden müssen. Europa hat dafür die besten Voraussetzungen. DIe EU ist 2012 völlig überraschend vom Nobelkomitee als Friedensstifter geehrt worden. Nur wenige außerhalb des Gremiums konnten sich die Entscheidung erklären. Jetzt sollte die Union die Gelegenheit nutzen und sich die Auszeichnung ein zweites Mal verdienen.