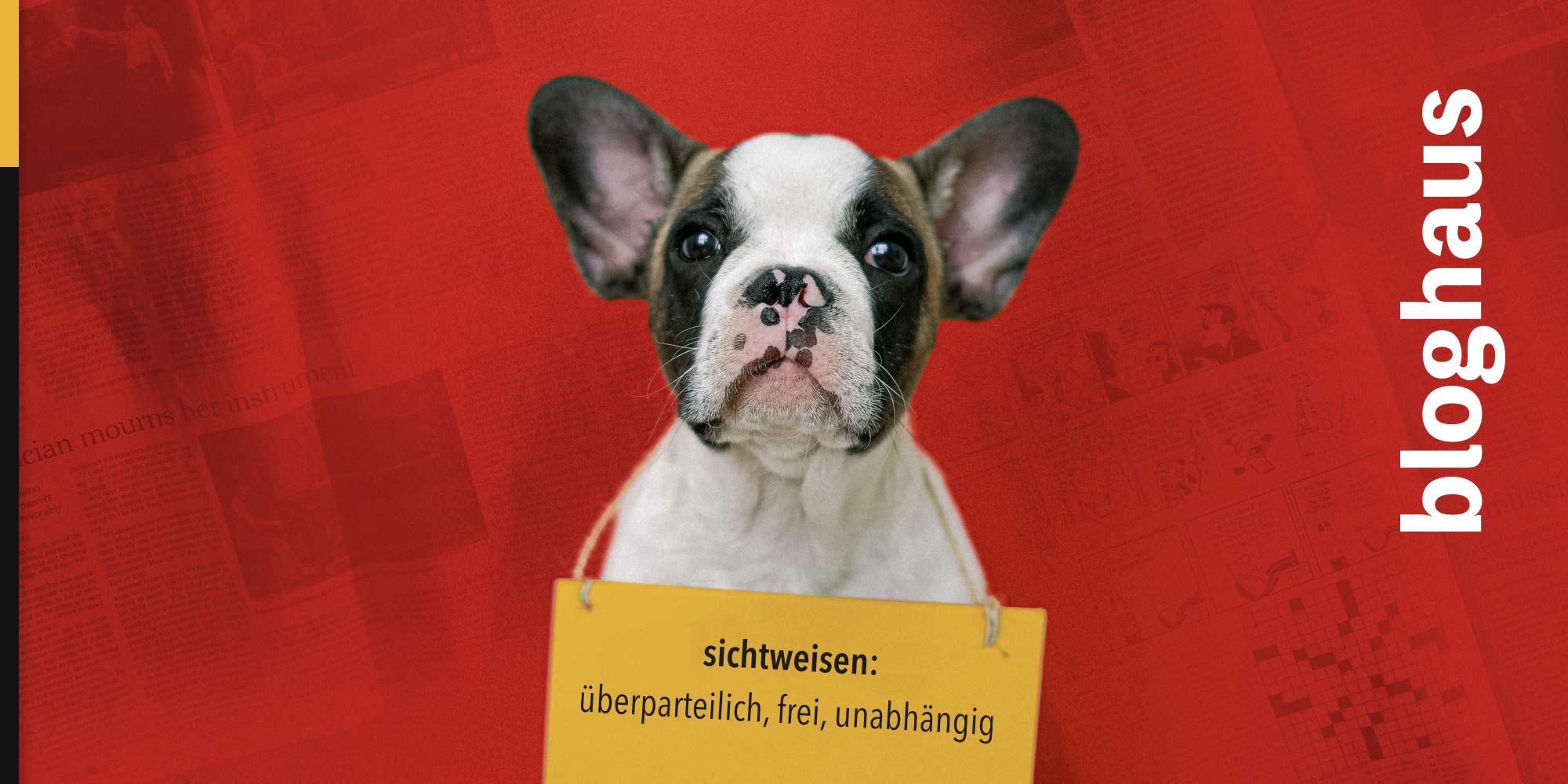– Die Klimapolitik droht am Wachstumszwang des Kapitalismus zu scheitern –
In der Klimapolitik macht sich Ernüchterung breit. Die hochfliegenden Pläne einer „großen Transformation“ von Wirtschaft und Gesellschaft mit dem Ziel der Begrenzung des Erderwärmung auf 1,5 Grad haben nicht erst mit der Abwahl von Regierungen mit ehrgeizigen Klimazielen empfindliche Dämpfer erhalten. Skepsis mit Blick auf die Umsetzbarkeit einer konsequenten Klimapolitik gibt es schon länger. Zum einen würde eine solche Politik, wenn sie irgendeine nachhaltige Wirkung entfalten soll, eine globale Kraftanstrengung erfordern. Da wären in erster Linie die USA, China, Indien und Europa mit Deutschland und seinem 1,6 Prozent Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß gefordert, aber auch all jene Länder, die sich noch in einem früheren Stadium der wirtschaftlichen Entwicklung befinden. Zum anderen erscheint es nach den Ergebnissen der letzten Wahlen in vielen Ländern der Welt unwahrscheinlicher denn je, dass sich für die notwendigen Maßnahmen einer Transformation auf Dauer demokratische Mehrheiten finden.
Zudem wäre, worauf die Wirtschaftsjournalistin Ulrike Hermann aufmerksam gemacht hat, eine wirkliche Klimatransformation nicht ohne einen Bruch mit den Prinzipien der kapitalistischen Wirtschaftsordnung mit ihrem inhärenten Wachstumszwang möglich. Zu diesem System gehören aber nicht nur raffgierige Börsenhaie und skrupellose Profitmaximierer, sondern auch die Konsumgesellschaft, der Wohlfahrtsstaat mit all seinen Segnungen, Pensionsfonds und weltweit wachsende Mittelschichten, die ihre Gewinne an Lebensqualität und Status einer dynamisch wachsenden Wirtschaft verdanken und Ersparnisse bilden, für die sie eine gewisse Rendite erwarten.
Jens Beckert, Direktor des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung in Köln, hat diese vertrackten Zusammenhänge in einem überaus lesenswerten Buch nachgezeichnet. Im Ergebnis kommt er zu einer recht pessimistischen Einschätzung der Steuerbarkeit moderner, kapitalistischer Gesellschaften in Richtung einer ökologischen Transformation. Im Anschluss an die Systemtheorie des Soziologen Niklas Luhmann sieht auch Beckert, dass kapitalistische Marktwirtschaften keine innere Selbstbegrenzung kennen und systemisch blind sind für ihre externen Effekte. Sie haben sich als Erfolgsmodell zwar weltweit durchgesetzt, aber um den Preis eines immer größeren Naturverbrauchs und der Externalisierung der Kosten ihres Wachstums in der Umwelt. Die tauchen in den Bilanzen der Unternehmen nicht auf, haben aber dennoch gravierende Auswirkungen auf die Überlebensbedingungen der Menschheit. Es ist dann Aufgabe der Politik, in die Wirtschaft regulierend einzugreifen, sei es in Form von Richtlinien und Gesetzen, sei es in Form von Steuern, um die Kosten des Umweltverbrauchs für die Wirtschaft spürbar zu machen.
Wachstumszwang
Das ist ein schwieriges Unterfangen, denn auch die Politik hat sich in modernen Gesellschaften von einer ständig wachsenden Wirtschaft abhängig gemacht. Die Perspektive unbegrenzten Wachstums, so Beckert, sei es letzten Endes gewesen, die es ermöglicht habe, Verteilungskonflikte einzuhegen und damit den gesellschaftlichen Zusammenhang zu sichern. Der Wohlfahrtsstaat in seiner jetzigen Form beruhe aber auf der Prämisse, dass durch Wachstum immer neue Verteilungsspielräume entstehen, die es erlauben, die von der kapitalistischen Wirtschaft erzeugten Ungleichheiten zu mildern und den Menschen ein Mindestmaß individueller Entfaltungsmöglichkeiten zu verschaffen. Im Gesellschaftsmodell des „Fordismus“ sei die industrielle Massenproduktion mit dem Massenkonsum verkoppelt worden, der immer mehr zur entscheidenden Legitimationsgrundlage der gesellschaftlichen Ordnung mutiert sei. Der postmoderne und postindustrielle Individualismus mit seinen Präferenzen für Optionenvielfalt, Selbstentfaltung und Lebensqualität habe daran wenig geändert. Auch er stelle sich bei näherer Betrachtung als „kultureller Bruder“ des Wachstumszwangs des Kapitalismus und seines sich weiter beschleunigenden Umweltverbrauchs heraus. Das begrenze die Gestaltungsmöglichkeiten der Politik empfindlich.
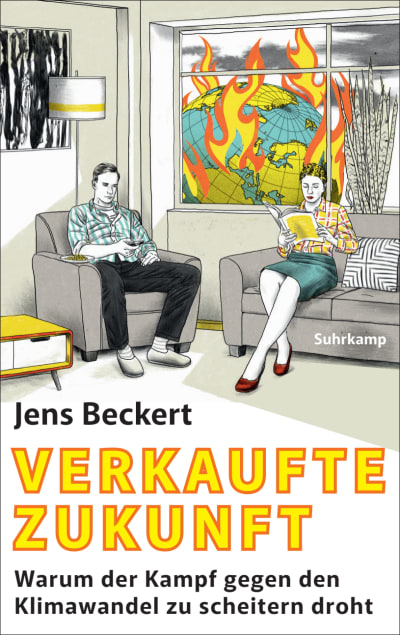
Verkaufte Zukunft – Warum der Kampf gegen den Klimawandel zu scheitern droht,
Jens Beckert,
Suhrkamp, Berlin,
ISBN 978-3-518-58809-3, 28 €
Beckert glaubt nicht daran, dass es gelingen kann, etwa durch CO₂-Steuern oder ähnliche Regulative zu einer Transformation in einem Umfang zu kommen, der aus Sicht der Klimaforschung notwendig wäre, um die Erderwärmung auf ein noch erträgliches Maß zu begrenzen. Selbstbegrenzung wäre ein Bruch mit zentralen gesellschaftlichen Funktionsprinzipien. Selbst für die Eindämmung des exzessiven Konsums der Superreichen dieser Welt (zur Hochzeit von Amazon-Chef Jeff Bezos in Venedig Ende Juni flogen angeblich 90 Privatjets aus aller Welt ein) hält Beckert für chancenlos, die Idee, mit CO₂-Steuern den exzessiven Ausstoß des Treibhausgases zu bestrafen und damit Verhaltensänderungen zu erzwingen für „völlig lebensfremd“. Zu stark seien die Widerstände, die jedem auch nur zaghaften Versuch der Begrenzung des umweltschädlichen Konsums entgegenschlagen, sodass der Politik wenig anderes übrig bleibe, als an dem fatalen Wachstumsmodell festzuhalten.
Eine nationale Perspektive ist für die Klimapolitik jedoch auf jeden Fall zu eng. Die Anreicherung von CO₂ in der Atmosphäre ist ein globales Phänomen. Nur wenn es gelänge, die notwendigen Schritte zur Reduzierung entsprechender Emissionen weltweit nachhaltig durchzusetzen, könnte auch die Klimatransformation gelingen. Für Beckert gibt es dafür jedoch keine Anzeichen. Noch spielen erneuerbare Energien im weltweiten Maßstab eine verschwindend geringe Rolle. In China, Indien und anderswo wird die fossile Energieerzeugung sogar noch kräftig ausgebaut. Schließlich hätten, wie Beckert hervorhebt, Klimafragen in Entwicklungsländern auf absehbare Zeit keine Priorität. Wichtiger erscheine dort die Hebung des Lebensstandards der Bevölkerung, der Gesundheitsversorgung und Ernährung. Für abstrakte Klimaziele könne dort kaum jemand mobilisiert werden, nicht zuletzt auch deshalb, weil es die reichen Länder des Westens waren, die die Klimakrise durch ihre Industrie und ihren Lebensstil herbeigeführt hätten.
Wo bleibt das Gemeinwohl?
Beckert ist grundsätzlich skeptisch, ob marktwirtschaftliche Steuerungsinstrumente wie die CO₂-Steuer oder der Handel mit CO₂-Zertifikaten ausreichend viel bewirken. Die „einseitig auf den Markt setzende Politik der letzten Jahrzehnte“ sei fehlgeleitet und gescheitert, schreibt er. Für eine entschiedene Politik der Regulierung des Umweltverbrauchs durch Gesetze und Richtlinien gebe es deshalb keine wirkliche Alternative. Eine Position, über die man streiten könnte. Auch Regulierungen müssen durchgesetzt werden und auch bei ihnen lässt sich nicht vermeiden, dass die Politik vor machtvollen gesellschaftlichen Interessengruppen einknickt und die Regeln so weit abschwächt, dass sie am Ende nichts mehr in Sachen Klimatransformation bewirken.
Ein Konzept für die Überwindung der Dilemmata und Blockaden der Klimapolitik bietet Beckert nicht an, allenfalls ein eher schwaches Plädoyer für die Wiederbelebung einer am Gemeinwohl orientierten Politik, die sich nicht nur an Nutzen und Gewinn, sondern auch an moralischen Maßstäben und der Pflege globaler Gemeinschaftsgüter, wie eben die Umwelt, orientiert. In einem solchen Rahmen wäre dann vielleicht mit einiger Aussicht auf Erfolg auch über Verzicht, Umverteilung und globale Solidarität zu sprechen, ohne die die Umweltkrise nicht zu bewältigen sei. Richtig überzeugt von den Chancen einer solchen Umorientierung scheint Beckert auch selbst nicht zu sein. Es bleibt im Ergebnis ein recht pessimistischer Ausblick auf die Chancen zur Klimarettung. Das Pendel schlägt hier unübersehbar zurück von der Idee der Nutzung der Kraft des Kapitalismus und des Marktes für die Klimarettung zu einer fundamentalen Systemskepsis, die aber letzten Endes ebenso kaum eine gangbare Handlungsperspektive aufzeigen kann. Beckerts empfehlenswertes Buch zeigt das große Potential, aber auch die Grenzen einer soziologisch-gesellschaftskritischen Analyse der Klimaproblematik.
Um diese Dimension geht es
Das Datenportal „Statista“ hat kürzlich auf eine Simulationsstudie von Jonathan D. Moyer von der Universität Denver hingewiesen, der durchgerechnet hat, welche sozialen und wirtschaftlichen Folgen eine konsequente Politik des Wachstumsverzichts („De-Growth“) bis in die Jahre 2050 oder 2100 haben könnte. Die Szenarien gehen aus von deutlich reduziertem Konsum, reduzierter Arbeitszeit, weniger Einsatz energieintensiver Techniken und damit niedrigerer Produktivität, flankiert von starken Umverteilungsmaßnahmen, um negative Einkommenseffekte bei den Armen abzufedern. Wenn diese Maßnahmen nur in den wohlhabenden Ländern des „globalen Nordens“ durchgeführt würden, wäre bis 2050 mit einem Rückgang des weltweiten Bruttoinlandsprodukts um mehr als 27 Prozent zu rechnen, einem leichten Rückgang der Armutsrate um 3,8 Prozent, aber auch mit einem leichten Rückgang der Lebenserwartung. Dennoch würden die Treibhausgasemissionen global nur um knapp 7 Prozent zurückgehen, zu wenig, um das Ziel der Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad zu erreichen. Würde diese Maßnahme nicht nur in den reichen, sondern auch in den armen Ländern durchgeführt, bräche das Wirtschaftsvolumen drastisch um zwei Drittel ein, die Armutsrate würde deutlich um 15 Prozent zunehmen und die Lebenserwartung um mehr als 4 Prozent sinken. Der Ausstoß von Klimagasen würde in diesem Modell bis 2050 um 25,6 Prozent zurückgehen, auch das allerdings zu wenig für die Erreichung der Ziele der Weltklimakonferenz von Paris im Jahr 2015, die von der Notwendigkeit einer Halbierung der CO₂-Emissionen bis 2030 gegenüber 1990 ausgehen. Klimapolitik nur in den reichen Ländern bringt also nicht genug. Weltweite Maßnahmen wären wirksamer, aber mit gravierenden Einschnitten und daraus folgenden Konfliktpotentialen verbunden.
Das Problem solcher Modellrechnungen ist allerdings, dass sie zwangsläufig auf Gegenwartswerten beruhen, etwa was die Energieeffizienz von Technologien und technischer Möglichkeiten der Reduzierung von Emissionen angeht. Auch die theoretisch zumindest gegebene Möglichkeit, quantitatives Wachstum mit immer mehr Rohstoff- und Energieverbrauch durch qualitatives Wachstum mit gleichbleibendem oder sogar rückläufigem Bedarf an materiellen Inputs zu ersetzen, ist in den Modellen nicht einbezogen. Dabei ist freilich zuzugestehen, dass diese Möglichkeit eines qualitativen Wachstums von vielen Ökonomen bestritten wird. Dennoch sind solche Szenarien sehr nützlich für eine Folgenabschätzung verschiedener politischer Strategien. Optimismus lässt sich aus den Rechnungen von Moyer jedenfalls ebenso wenig schöpfen wie aus den soziologischen Betrachtungen von Jens Beckert.
Titelbild: Entique/ Pixabay