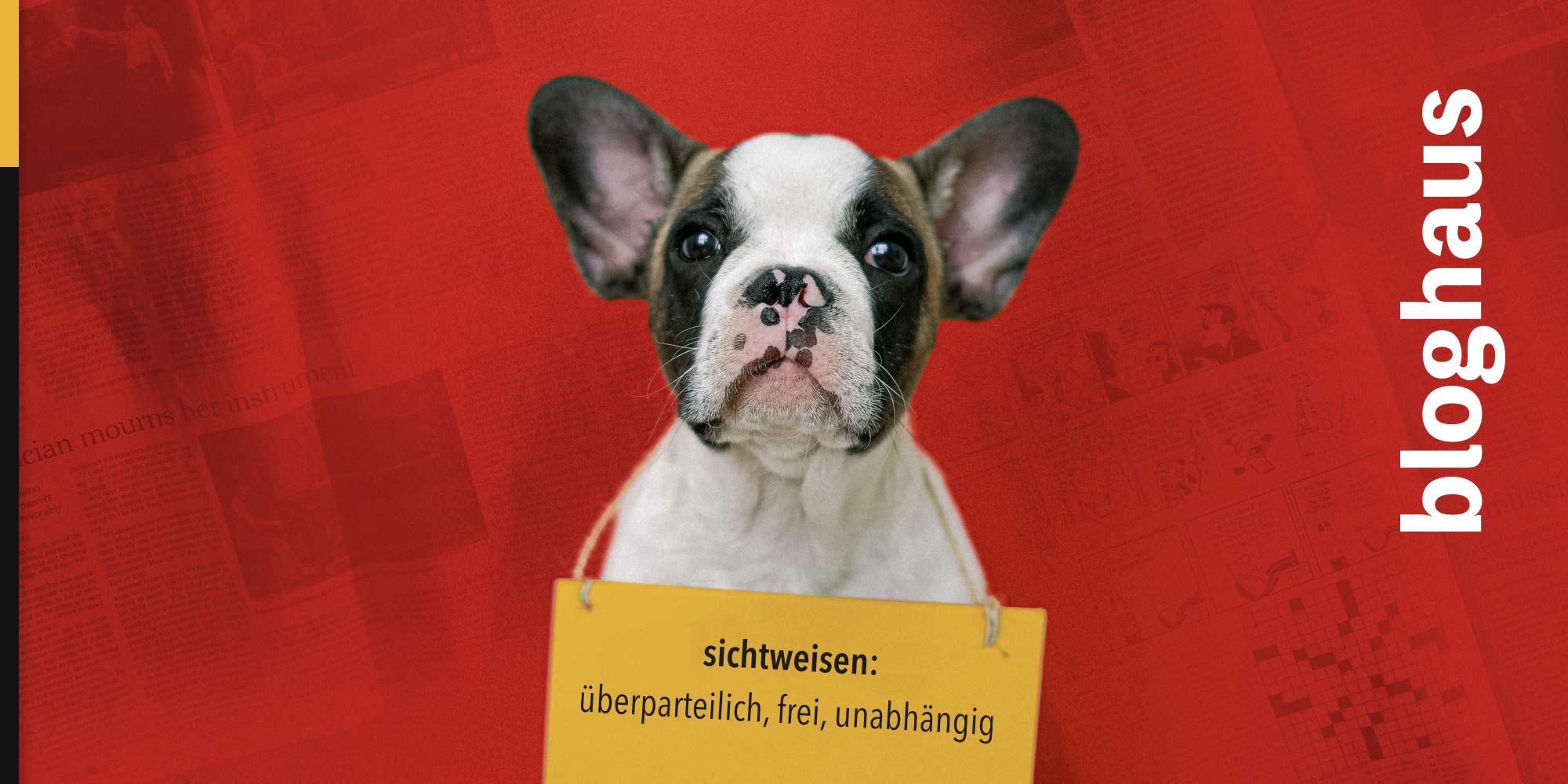– Mit ihrem Vertrag können die Koalitionäre noch keine Aufbruchstimmung erzeugen –
Bereits unmittelbar nach Bekanntgabe des vorläufigen Ergebnisses der Bundestagswahl war klar: CDU/CSU und die SPD sind zum Koalieren verdammt, zu diesem Zweckbündnis gibt es keine Alternative, will sich Deutschland sich in einer sich rasch verändernden Welt behaupten und sich im Innern nicht an rechte Populisten verlieren. Unter diesem Zwang haben die beiden künftigen Regierungsparteien geliefert und einen 144-seitigen Koalitionsvertrag vorgestellt, der, ob seiner vielen lahmen Kompromisse und Unentschieden, freilich nicht annähernd den Wumms in sich trägt, den der vorgelagerte Gewaltakt eines mit Hilfe der Grünen hunderte Milliarden Euro schweren Finanzpakets für Verteidigung und Infrastruktur erhoffen ließ. Gewaltakt deshalb, weil dieses Finanzpaket wegen der erforderlichen Zweitdrittelmehrheit noch vom alten Bundestag beschlossen werden musste. Im neuen Bundestag hätten dafür AfD oder Linke zustimmen müssen.
Für dieses Vorgehen hat Merz einen hohen Kredit auf seine Glaubwürdigkeit aufnehmen müssen, denn während des Wahlkampfs hatte er ein solches Finanzpaket noch strikt abgelehnt. Damals antwortete er während des Duells mit Olaf Scholz auf dessen Frage nach der Finanzierung seiner Projekte schwammig, dass dies mit mehr Wirtschaftswachstum und der Streichung des Bürgergeldes möglich wäre. Klar, diese Rechnung konnte nicht aufgehen und die Realität hat Friedrich Merz schnell eingeholt. Mit dieser „Glaubwürdigkeitshypothek“, insbesondere in den eigenen Reihen, muss er noch eine Weile leben, um seiner Partei die Rückkehr an die Macht zu ermöglichen.
Insofern war es nicht verwunderlich, dass Friedrich März gemeinsam mit den Parteispitzen von CSU und SPD den Koalitionsvertrag betont unaufgeregt und nüchtern präsentierten. „Wir wissen, was auf dem Spiel steht“! Dies war einer der Kernsätze, mit denen Friedrich Merz den zu Papier gebrachten Pakt vorstellte. Damit beschrieb er sehr griffig, worum es künftig geht: Die vielleicht letzte Chance, die demokratische Mitte, das demokratische System in Deutschland wieder zu stabilisieren und verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen, denn die Stärke der AfD hängt auch damit unmittelbar zusammen. Deshalb ist es zunächst eine gute Nachricht, dass sich Union und SPD auf einen Koalitionsvertrag geeinigt haben und damit entsprechend dem Titel des Vertrages „Verantwortung für Deutschland“ übernehmen.
Natürlich, jeder weiß das aus der Vergangenheit, dass Koalitionsverträge das eine sind, Papier ist ja bekanntlich geduldig, die konkreten Weltereignisse aber das andere, die schriftlich fixierte Formeln schnell zur Makulatur werden lassen können. Das Programm wird bald vergessen sein, sich im politischen Alltag abschleifen. Die ehemalige Ampelkoalition kann davon ein Lied singen. Und Donald Trump zeigt uns aktuell jeden Tag aufs Neue, wie er aus einer Laune heraus, bisher geltende Regeln ganz schnell außer Kraft setzen und die Weltwirtschaft in eine Krise stürzen kann.
Der 144-seitige Koalitionsvertrag enthält – wie könnte es auch anders sein – viele Kompromisse, eingebettet in Absichtserklärungen und Ankündigungen ganz nach dem Motto: Später vielleicht, statt jetzt sofort. Der wichtigste Satz steht auf Seite 51: „Alle Maßnahmen des Koalitionsvertrages stehen unter Finanzierungsvorbehalt“. Eine sehr eindeutige Formulierung, die der Co-Vorsitzende der SPD Lars Klingbeil auch ausdrücklich hervorhob und in diesem Zusammenhang auf kleine, aber feine Formulierungsunterschiede verwies: „Wir wollen bedeutet, wir nehmen es uns vor; ob es aber finanziert werden kann, muss am Ende geprüft werden. Deswegen gibt es nur ganz wenigen Verabredungen, die mit wir werden beginnen.“
Die Ökonomie
Zu diesen „wir werden Vorhaben“ gehören unter anderem Neue Abschreibungsmöglichkeiten zur Entlastung von Unternehmen und zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Bereits in diesem Jahr soll ein sogenannter „Investitions-Booster“ in Form einer degressiven Abschreibung auf Ausrüstungsinvestitionen von 30 Prozent für die Jahre 2025 bis 2027 eingeführt werden. Davon dürften insbesondere großen Unternehmen profitieren, denn wenn sie nun investieren, mindern die damit verbundenen Kosten zunächst kräftig den zu versteuernden Gewinn.
Außerdem wird nach dem Wunsch der CDU die Körperschaftssteuer von aktuell 15 auf 10 Prozent gesenkt, allerdings – der Kompromiss lässt grüßen – in fünf Schritten jeweils um einen Prozentpunkt beginnend ab 2028.
Neben diesen verbesserten steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten für Investitionen und den vorgesehenen geringeren Abgaben auf den Strompreis will die künftige Koalition im Rahmen einer Investitionsoffensive einen „Deutschlandfonds“ , ein zentrales Anliegen der SPD, einrichten, der expansionswilligen Unternehmen mit Kapitalspritzen helfen soll. Hierfür will der Bund „mindestens zehn Milliarden Eigenmittel durch Garantien oder finanzielle Transaktionen bereitstellen“. Mithilfe von „privatem Kapital und Garantien“ soll dieser Fonds auf „mindestens 100 Milliarden Euro“ wachsen. Weiterhin sollen öffentliche Finanzierungsprogramme auch für die Sicherheits- und Verteidigungsoffensive geöffnet werden bzw. die Bundesagentur für Sprunginnovationen (SPRIND) gestärkt und ermöglicht werden, dass sie auch im Bereich der Verteidigung tätig werden kann. Der Bürokratieabbau soll unter anderem mit der Abschaffung des nationalen Lieferkettengesetzes ermöglicht werden.
Steuern steuern
Wenig Bewegung und Konkretes ist dagegen bei der Einkommenssteuer zu erkennen. Hierzu heißt es im Koalitionsvertrag lediglich, dass zur Mitte der Legislaturperiode die Einkommenssteuer für kleine und mittlere Einkommen gesenkt wird. Immerhin heißt es hier „wir werden“, was der Kanzler in spe, Friedrich Merz, inzwischen aber unter Finanzierungsvorbehalt stellt, ebenso wie die sicher geglaubte Anhebung des Mindestlohns auf 15 Euro. Laut Vertrag soll die Einführung des Mindestlohns in Höhe von 15 Euro, einem besonderen Anliegen der SPD, im Jahr 2026 insofern erreicht werden, dass die Mindestlohnkommission die allgemeine Lohnentwicklung etwas anders bewertet in der Weise, dass sich die Kommission in der Gesamtabwägung „sowohl an der Tarifabwicklung als auch an 60 Prozent des Bruttomedianlohns von Vollzeitbeschäftigten orientiert.
Der Solidaritätszuschlag bleibt auf Wunsch der SPD unverändert bestehen. Dieser belastet nach der Reform von 2021 allerdings nur noch Gutverdiener, Kapitalanleger und Unternehmer. Insofern konnten die Sozialdemokraten, deren Forderungen nach der Wiederbelebung der Vermögenssteuer, der Erhöhung der Reichensteuer und der Anhebung der Abgeltungssteuer, mit denen sie sich nicht durchsetzen konnten, zumindest durch die Hintertür doch noch erreichen, dass große Einkommen ein wenig stärker besteuert werden.
Weiterhin soll die Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie dauerhaft auf sieben Prozent gesenkt werden, allerdings erst ab 2026. Zudem wird die Agrardiesel-Subvention wieder eingeführt. Zur Gegenfinanzierung sollen unter anderem Förderprogramme des Bundes gestrichen und Stellen in der Verwaltung abgebaut werden.
Migration und Recht
Bei dem im Wahlkampf beherrschendem Thema Migration setzen die künftigen Koalitionäre auf mehr Begrenzung und eine Rückführungsoffensive. So sollen beispielsweise freiwillige Bundesaufnahmeprogramme etwa für Afghanistan beendet und der Familiennachzug für subsidiär Schutzbedürftige für die Dauer von zwei Jahren ausgesetzt werden. Für das Streitthema „Zurückweisungen an den Grenzen“ wurden in der Weise ein Kompromiss gefunden, als diese – auch bei Asylgesuchen – „in Abstimmung mit den europäischen Nachbarn“ vorgenommen werden sollen. Die Grenzkontrollen werden „bis zu einem funktionierenden Außengrenzschutz und der Erfüllung der bestehenden Dublin- und GEAS-Regelungen durch die Europäische Gemeinschaft“ fortgesetzt. Außerdem sieht der Vertrag vor, dass die europäische Grenzschutzagentur Frontex beim Grenzschutz und bei Rückführungen gestärkt wird.
Mit diesem Kompromiss, hier insbesondere dem Zusatz in „Abstimmung mit den europäischen Nachbarn“, musste Friedrich Merz von seinem während des Wahlkamps geäußerten markigen Worten abrücken und die europäische Rechtslage anerkennen. Ursprünglich wollte er quasi in Trump-Manier am Tag nach seiner Wahl zum Bundeskanzler das „Bundesinnenministerium anweisen, die deutschen Staatsgrenzen zu all unseren Nachbarn dauerhaft zu kontrollieren und ausnahmslos alle Versuche der illegalen Einreise zurückzuweisen“. Die SPD machte hier, völlig zu Recht, rechtliche Bedenken geltend. Wie bloghaus.eu bereits berichtete, steht die sogenannte Dublin III Verordnung einer sofortigen Zurückweisung entgegen. Diese Verordnung, die nationales Recht überlagert, sieht vor, dass bei Stellung eines Asylantrags zunächst ein „Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedsstaats“ einzuleiten ist. Dies bedeutet, dass geprüft werden muss, welcher Staat für das Asylverfahren zuständig ist. Diese Feststellung muss ein deutsches Verwaltungsgericht treffen, erst danach darf Deutschland dann an den zuständigen Staat überstellen.
Mit dieser Regelung soll auch vermieden werden, dass Asylsuchende nicht in Europa umherirren und von einem Land in das andere geschickt werden. Im Prinzip sind für die Asylverfahren nicht die deutschen Nachbarländer, sondern die Mitgliedsstaaten an der EU-Außengrenze zuständig. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die Betroffenen bereits in einem Land an der EU-Grenze registriert sind. Im Übrigen können nur Flüchtlinge an der deutschen Grenze zurückgewiesen werden, die keinen Asylantrag stellen und den auch nicht in einem anderen Land gestellt haben.
Fakt ist aber auch, dass in der Tat das Dublin-System nicht richtig funktioniert. Diese Dysfunktionalität darf aber nicht dazu führen – nach dem Prinzip „Auge um Auge“ – EU-Rechtsvorschriften zu ignorieren, weil andere Staaten ihre Pflichten aus dem gleichen Rechtsakt missachten. Auch der neue Pakt zu Migration und Asyl der Europäischen Union dürfte an der bisherigen Praxis wenig ändern. Diese neue Reform, mit der die grundlegenden Probleme des gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) gelöst werden sollen, sieht unter anderem eine neu gestaltete Verordnung zur Asyl- und Migrationssteuerung vor, die die ungleiche Verteilung der Zuständigkeiten zwischen den Mitgliedsstaaten ausgleichen soll, da bislang insbesondere die südlichen EU-Länder unverhältnismäßig stark belastet sind, da sie als Einreiseländer für den Asylprozess zuständig sind. Mit dem Inkrafttreten dieses Pakts im kommenden Jahr ist ein flexibler „Solidaritätsmechanismus“ vorgesehen, der alle Mitgliedsstaaten dazu verpflichtet, einen Beitrag entweder durch Aufnahme von Asylbewerbern, finanzielle Hilfen oder Sachleistungen zu leisten. Allerdings behält auch das neue System die umstrittene Ersteinreise bei, die die Hauptverantwortung für schutzsuchende Menschen den Grenzstaaten auferlegt. Die grundsätzliche Schieflage bleibt demnach bestehen.
Mit dem jetzt gefundenen Formelkompromiss einer Zurückweisung in Abstimmung mit den europäischen Nachbarn ist zumindest ein geordnetes Verfahren gesichert. Gleichwohl scheint zwischen den Koalitionären noch unklar zu sein, was „in Abstimmung“ konkret bedeutet beziehungsweise wie verfahren werden soll, wenn beispielsweise Österreich die Rücknahme eines Geflüchteten ablehnt. Unabhängig davon dürfte auch klar sein, dass es sich bei dieser Regelung nur um eine vorübergehende Maßnahme handeln kann bzw. in Europa ein funktionierendes Migrationsmanagement gefunden werden muss.
Darüber hinaus will Schwarz-Rot die Möglichkeit zu Asylverfahren in Drittstaaten schaffen und deswegen auf europäischer Ebene erreichen, dass das sogenannte Verbindungselement gestrichen wird, „um Rückführungen und Verbringungen zu ermöglichen“. Dies heißt, dass dann ein Migrant keinerlei Verbindung mehr zu einem Land braucht, in das er gebracht wird. Daneben sollen mehrere Maßnahmen die Abschiebezahlen erhöhen. Dazu gehören beispielsweise, dass Ausreisepflichtige in Abschiebehaft genommen werden können, der dauerhafte Arrest für ausreisepflichtige Gefährder und Täter nach Verbüßung ihrer Haftstrafe geschaffen wird. Das Recht auf Asyl bleibt aber weiterhin bestehen.
Beim Thema Innere Sicherheit will die künftige Koalition insbesondere die dreimonatige Speicherpflicht für IP-Adressen einführen. Zudem soll die Bundespolizei zur Bekämpfung schwerer Straftaten die Erlaubnis zur Telekommunikationsüberwachung bekommen. Die teilweise Legalisierung von Cannabis wird – entgegen den Versprechungen der Unionsparteien während des Wahlkampfs – vorerst nicht rückgängig gemacht werden, sondern im Herbst ergebnisoffen evaluiert werden.
Soziale Pflichtsysteme
Bei einem weiteren wichtigen und durchaus streitigen Thema, dem Bürgergeld, das auch im Wahlkampf eine dominierende Rolle spielte, haben sich die Koalitionäre dahingehend geeinigt, dass das Bürgergeld in eine Grundsicherung umgewandelt wird, bei der die Sanktionen deutlich verschärft werden – bis hin zu einer vollständigen Streichung der Leistung. Mit dieser Maßnahme sollen Leistungsbezieher wieder stärker zur Arbeit angehalten werden. Wer Arbeit ablehnt oder Termine im Jobcenter ignoriert, soll schneller Sanktionen, also Kürzungen, spüren. Weiterhin sollen Bezieher von Sozialleistungen, insbesondere der Grundsicherung, die Möglichkeit haben, dass ein Hinzuverdienst nicht mehr voll mit der Sozialleistung verrechnet wird, wie dies gegenwärtig der Fall ist. Im Übrigen sollen soziale Leistungen zusammengefasst und besser aufeinander abgestimmt, etwa durch die Zusammenführung von Wohngeld und Kindergeldzuschlag.
Bei dem komplexen Thema Rente hat sich die Koalition zunächst darauf geeinigt, dass das derzeitige Rentenniveau von 48 Prozent bis zum Jahr 2031 abgesichert wird; die Mehrausgaben sollen aus Steuermitteln ausgeglichen werden. Gleichzeitig soll aber eine Rentenkommission eingerichtet werden, die bis zur Mitte der Legislatur eine „neue Kerngröße für ein Gesamtversorgungsniveau über alle drei Rentensäulen, also die öffentlich-rechtlichen Pflichtsysteme, die betriebliche Altersversorgung sowie die private Vorsorge, prüfen soll. Weiterhin ist für 2026 die Einführung einer neuen „Frühstartrente“ vorgesehen. Für alle Schüler von sechs bis 18 Jahren will der Staat pro Monat zehn Euro auf ein individuelles Altersvorsorgedepot einzahlen, die bis zum Renteneintritt steuerfrei gestellt werden sollen.
Darüber hinaus soll ein abschlagsfreier Renteneintritt nach 45 Beitragsjahren auch künftig möglich bleiben. Gleichzeitig werden aber auch finanzielle Anreize für ein längeres Arbeiten geschaffen. Wer nach dem Erreichen des gesetzlichen Rentenalters freiwillig weiterarbeitet, bekommt sein Gehalt bis zu 2000 Euro im Monat steuerfrei.
Wie von der CSU verlangt, soll auch die sogenannte Mütterrente erweitert werden, allerdings heißt es hier „wir wollen“, das heißt, sie steht unter Finanzierungsvorbehalt.
Wohnbau-Turbo
Beim Thema Bauen und Wohnen sieht der Vertrag vor, den Wohnungsbau durch „eine Investitions-, Steuerentlastungs- und Entbürokratisierungsoffensive“ anzukurbeln. Hierfür sollen das Baugesetzbuch novelliert und in den ersten 100 Tagen ein Gesetzentwurf zur „Einführung eines Wohnungsbau-Turbos unter Berücksichtigung der kommunalen Planungshoheit vorgelegt sowie Lärmschutzfestsetzungen erleichtert werden. Befristet sind wieder Fördermittel nach dem KfW-Standard geplant. Auch das Förderprogramm „Junges Wohnen“ soll ausgebaut werden und für den Bau von Sozialwohnungen wird es mehr Förderung geben. Daneben soll die Mietpreisbremse in angespannten Wohnungsmärkten um vier Jahre verlängert werden. Eine Expertengruppe mit Mieter- und Vermieterorganisationen wird zugleich beauftragt, „die Harmonisierung von mietrechtlichen Vorschriften“ vorzulegen.
In der Gesundheits- und Pflegepolitik soll die 2024 beschlossene Krankenhausreform bis zum Sommer dieses Jahres gesetzlich weiterentwickelt werden, um die Grund- und Notfallversorgung auf dem Land zu sichern. Außerdem wird eine große Pflegereform angekündigt, die von einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe auf Ministerebene noch in diesem Jahr erarbeitet werden soll.
Fragen der Sicherheit
Im Bereich der Außen- und Verteidigungspolitik bekennen sich Union und SPD ausdrücklich zur NATO und der EU. Auch das transatlantische Bündnis und die enge Zusammenarbeit mit den USA bleibt für die Koalitionäre „von zentraler Bedeutung“. Zugleich bekennen sie sich zur „umfassenden Unterstützung“ der Ukraine. Die Verteidigungsausgaben sollen „bis zum Ende der Legislaturperiode deutlich und stringent steigen“ und sich nach den in der NATO gemeinsam vereinbarten Fähigkeitszielen richten. Ferner soll – nach dem schwedischen Muster – ein freiwilliger neuer Wehrdienst geschaffen werden. Der Wiederaufbau soll bereits in diesem Jahr beginnen.
In der Außenpolitik sieht der Koalitionsvertrag unter anderem einen „Nationalen Sicherheitsrat im Bundeskanzleramt“ vor. Dies war ein besonderes Anliegen von Friedrich Merz. Hierzu soll der bisherige Bundessicherheitsrat, der zuletzt vor allem geheim über Rüstungsexporte entschieden hatte, weiterentwickelt werden. Der Nationale Sicherheitsrat soll „die wesentlichen Fragen einer integrierten Sicherheitspolitik koordinieren, Strategieentwicklung und strategische Vorausschau leisten, eine gesamte Lagebewertung vornehmen und somit das Gremium der gemeinsamen politischen Willensbildung sein“. Damit wird im Kanzleramt immer mehr außen- und sicherheitspolitische Kompetenz konzentriert.
Was kittet dieses Bündnis?
Wie geht es nun weiter? Nachdem der Vorstand von CSU dem Koalitionsvertrag bereits zugestimmt hat, steht noch die Zustimmung der CDU aus, hierzu wird ein kleiner Parteitag einberufen. Die SPD wird im Rahmen eines Mitgliederentscheids bis Ende April entscheiden. Danach könnte dann Friedrich Merz in der Woche ab dem 5. Mai zum Bundeskanzler gewählt werden. Die Sozialdemokarten werden sicher mit einigem Bauchgrummeln zustimmen, was wäre auch die Alternative? Nachverhandlungen wie von dem Juso-Vorsitzenden Philipp Türmer ins Spiel gebracht, sind eher unwahrscheinlich. Was wäre im Falle eines Scheiterns? Neuwahlen? Mitnichten.
Immerhin haben die Sozialdemokraten -mit Hilfe der Grünen – den Unionsparteien das Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für Investitionen und Infrastruktur und den Klimaschutz abgerungen und ihre zentrale Forderung nach einem Deutschlandfonds für Investitionsanreize durchsetzen können. In der Sozialpolitik konnte die Union zwar ihre Forderung nach Abschaffung des Bürgergelds erreichen und durch eine Grundsicherung ersetzen. Realistisch betrachtet, kann man hier aber eher von einer begrifflichen Abschaffung sprechen.
In der Rentenpolitik konnte sich die SPD durchsetzen und das Rentenniveau von 48 Prozent zumindest bis 2031 halten bzw. im Koalitionsvertrag verankern. Auch die Mindestlohnforderung von 15 Euro pro Stunde wird im Vertrag zumindest erwähnt, auch wenn der Weg dorthin ein wenig unklar bleibt. Die CSU wird ihre Mütterrente bekommen und die CDU, wenn auch etwas später als erhofft, die Senkung der Körperschaftssteuer. Außerdem konnte die Union die Forderung der SPD nach Steuererhöhungen für Besserverdienende abwehren. Dafür wird der Soli nicht abgeschafft.
Im Übrigen erhält die SPD sieben Ministerien darunter das Finanz-, Verteidigungs- und Arbeitsministerium.
Aber unabhängig davon, wer sich wo durchgesetzt hat, wieviel Ministerien eine Partei bekommen hat, jetzt muss geliefert werden, und zwar vom ersten Tag an. Keinesfalls dürfen Union und SPD wieder in den „Ampelhampelmodus“ verfallen. Zumindest das Geld ist diesmal vorhanden, jetzt geht es darum, es sinnvoll auszugeben. Sicher, die Herausforderungen, die Verantwortung die auf dieser Koalition lasten wird, könnten kaum größer sein. „Wir wissen, was auf dem Spiel steht.“ Dieser Satz von Friedrich Merz mag dann vielleicht auch der Kitt sein, der diese Koalition zusammenhält, weil von ihren Entscheidungen die Zukunft Deutschlands abhängt. Es wäre furchtbar, wenn die AfD einfach nur zuschauen müsste, wie diese Koalition nicht funktioniert. Die aktuellen Umfragen weisen die Richtung. Deshalb sind Union und SPD dazu verdammt, die großen Aufgaben zu wuppen und auch mit den Personalien zur Bildung des Kabinetts schnell eine Aufbruchstimmung zu erzeugen. Denn Signale des Aufbruchs sendet der sich im Klein-Klein verlierende Koalitionsvertrag allein nicht.