In seiner Studie „Leidenschaften und Interessen“ aus dem Jahr 1977 hat der Ökonom Albert O. Hirschmann gezeigt, wie der Begriff des „Interesses“ zu Beginn der Neuzeit zum Zentralbegriff der politischen Staatslehre wurde. Er verkörperte das Gegenmodell zu den Leidenschaften des Glaubens, die in den Religionskriegen des 17. Jahrhunderts Deutschland und Europa ins Chaos gestürzt hatten. Interessen wurden so etwas wie die verborgene Kraft, die das menschliche Handeln, wechselnde Befindlichkeiten und Konflikte erklärbar machten. Der Begriff des Interesses öffnete zudem einen gedanklichen Raum für Kompromisse, während das Universum der Leidenschaften nur den richtigen und den falschen Glauben kannte. Vielfältige Motive auf Interessen zurückzuführen ist aber immer auch eine „Reduktion von Komplexität“, wie es der Soziologe Niklas Luhmann ausdrücken würde, eine Reduktion, die stets das Risiko mitführt, Wichtiges zu übersehen und von Entwicklungen überrascht zu werden, die in der Mechanik der Interessen nicht zu erwarten waren. Ganz abgesehen davon, dass eine Politik der nackten Interessen schnell jede Gefolgschaft verlieren würde, wenn sie sich nicht auch an Werte bindet und damit Legitimität verschafft.
Vor diesem Hintergrund einige Anmerkungen zu Klaus von Dohnanyis Buch „Nationale Interessen. Orientierung für deutsche und europäische Politik in Zeiten globaler Umbrüche“. Darin formuliert der „Elder Statesman“ der Sozialdemokratie, Staatssekretär, Bildungs- und Wissenschaftsminister in der Regierung von Willy Brandt und den 1980er Jahren Erster Bürgermeister von Hamburg den Anspruch,„Orientierung für deutsche und europäische Politik in Zeiten globaler Umbrüche“ zu geben. Er plädiert dabei für einen nüchternen Blick auf Interessen der Nationen und warnt davor, sich von einem sentimentalen Wertediskurs in die Irre führen zu lassen. Das Buch ist kurz vor dem militärischen Überfall Russlands auf die Ukraine abgeschlossen worden und spiegelt Einschätzungen eines bedeutenden und einflussreichen Sozialdemokraten am Vorabend der „Zeitenwende“ zu einem heißen Krieg auf europäischem Boden. Das macht es auch zu einem Zeitdokument, das Einblick gibt in den „Mindset“ von in der Tradition der Friedenspolitik Willy Brandts stehenden Sozialdemokraten, die ihren inneren Kompass neu justieren müssen, nachdem die Politik, den Frieden durch Kooperation, wirtschaftliche Verflechtung und kulturellen Austausch zu sichern, zumindest vorläufig an ein Ende gekommen zu sein scheint.
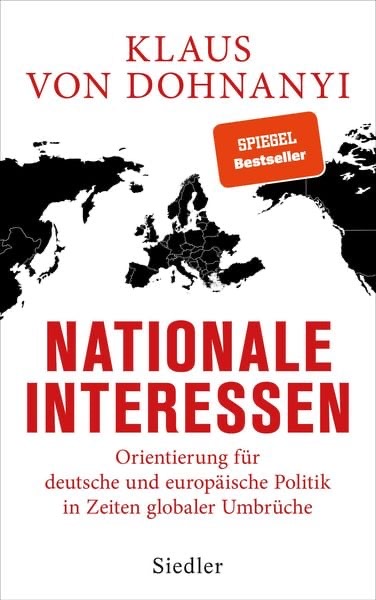
Nationale Interessen.
Orientierung für deutsche und europäische Politik in Zeiten globaler Umbrüche.
Klaus von Dohnanyi, Siedler-Verlag, München 2022, 22 Euro (gebundene Ausgabe)
ISBN 978-3-8275-0154-7
Dohnanyi grenzt sich ab von einem „billigen Anti-Amerikanismus“, geht aber doch sehr kritisch mit den USA als größter Weltmacht ins Gericht. Die Neigung zur Selbstbezogenheit in Verbindung mit dem Hang zu imperialen Übergriffen sieht er schon sehr früh im politischen Selbstverständnis der USA verankert, in ihrem „Exzeptionalismus“, in dem sie sich als auserwählte Nation sieht, mit der Mission, ihr Modell von Demokratie, Freiheitsrechten und Kapitalismus in aller Welt zu verbreiten. Amerikanische Politik ist, wie Dohnanyi sie sieht, ausschließlich an den Interessen der USA in ihrer imperialen Rolle als Weltmacht ausgerichtet. Demokratische Werte werden, so Dohnanyi, zitiert, wenn sie nützlich sind und Gefolgschaft sichern, aber ebenso schnell wieder verraten, wenn das Machtkalkül die Kooperation mit Autokraten und Diktatoren als zweckmäßig erscheinen lässt. Auf eine „Wertegemeinschaft“ mit den USA zu setzen sei sträfliche Naivität.
Die NATO ist in den Augen Dohnanyis wenig mehr als ein Instrument der USA zu Sicherung ihrer Dominanz und ihrer wirtschaftlichen und militärischen Interessen. Misstrauen ist hier, so scheint es, die einzig gebotene Haltung. Dohnanyi sieht das Verhalten der NATO nach dem Zusammenbruch des Sozialismus und der Sowjetunion 1990 als Beleg für diese These. Er macht sich dafür ein (bisher vor allem auf der äußersten Linken verbreitetes) Narrativ zu eigen, nach dem der Westen entgegen seinen Zusagen an Gorbatschow in den Endzügen der Sowjetunion die Ausdehnung der NATO nach Osten vorangetrieben und damit Russland gezielt in die Enge getrieben habe. Nun ist es äußerst strittig, ob es eine solche Zusage zur Selbstbegrenzung der NATO jemals gegeben hat. Nicht zu übersehen ist auch, dass es das Verhalten des nachsowjetischen Russlands war, das die ehemaligen Mitgliedstaaten des Warschauer Pakts in Mittel-, Ost- und Südosteuropa sowie die ehemaligen Sowjetrepubliken im Baltikum dazu gebracht hat, ihre Sicherheit in der Mitgliedschaft in der NATO zu suchen, teilweise bestätigt durch Volksabstimmungen mit überwältigenden Mehrheiten für den Beitrittsantrag. Von Tschetschenien und den Tschetschenienkriegen, die schon früh gezeigt haben, mit welch brutalen Mitteln Russland seine Interessen durchzusetzen gewillt ist, wird im ganzen Band bezeichnenderweise nicht einmal gesprochen. Man hat nicht das Gefühl, dass der Autor sich hier um ein ausgewogenes Urteil bemüht. Die Quellen, die er zum Beleg seiner Thesen heranzieht, sind sehr selektiv ausgewählt. Einen Überblick zur Debatte zu diesen brisanten Themen ist von Dohnanyi wohl auch gar nicht gewollt.
Auch die These, dass man Russland durch das Ignorieren seiner vitaler Interessen der Atommacht und seine Kränkung durch ständiges Messen an westlichen Maßstäben von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit Europa entfremdet und an die Seite Chinas getrieben habe, entwirft ein sehr angestrengtes Opfernarrativ, dem man widersprechen muss. Wenn Dohnanyi behauptet, die Aufnahme der Ukraine in die NATO habe nach der Krim-Besetzung gewissermaßen unmittelbar bevorgestanden, ist das eindeutig falsch. Nach dem Angriff Russlands vom 24. Februar könnte man eher zur Auffassung gelangen, dass dieser möglicherweise zu vermeiden gewesen wäre, wenn man der ohnehin massiv bedrängten Ukraine den Beitritt zur NATO nicht verweigert hätte. Hier strickt Dohnanyi an Legenden, die den Verlautbarungen der Kreml-Propaganda in ihrer Wahrheitsferne kaum nachstehen.
Dohnanyis Urteil ist in dieser Sache denkbar unausgewogen und nicht weit von dem „billigen Anti-Amerikanismus“ entfernt, von dem er sich doch zu Anfang seines Buches so wohltuend distanziert hat. Das ist schade, denn bei manchen Fragen hat er durchaus einen Punkt, etwa bei der Analyse der Weltmachtstrategie der USA und dem Hinweis auf die Instrumentalisierung Europas für den Konflikt zwischen den USA und China.
Der Krieg in der Ukraine, wie schon zuvor die Auseinandersetzungen auf dem Westbalkan und die gescheiterte Mission in Afghanistan haben die Schwäche Europas und der Europäischen Union offengelegt. Europa ist, wenn es darauf ankommt, uneinig und spielt trotz einer Bevölkerung von fast einer halben Milliarde Menschen und einem Bruttoinlandsprodukt von fast 15 Billionen Euro in den geopolitischen Spannungsfeldern keine eigene Rolle. Wenn man die Marginalisierung Europas beenden will, wäre es eigentlich sinnvoller zu fragen, wie es stark und handlungsfähig werden kann, als – wie Dohnanyi – den USA zum Vorwurf zu machen, dass sie ihren Vorteil suchen. Wer wollte es einem Hegemon vom Format der USA verdenken, wenn er die Chancen entschlossen nutzt, die sich durch das transatlantische Ungleichgewicht und das Fehlen eines europäischen Gegenparts bieten. Dazu kommt, die USA haben sich Europa gegenüber doch eher als benevolenter, freundlicher Hegemon verhalten, wenn man es mit dem Verhalten anderer Großmächte in deren Einflussbereichen vergleicht. So ganz nebensächlich scheint die gemeinsame Wertbasis der Demokratien des Westens doch nicht zu sein.
Wie also kann Europa stärker werden? Die Gedanken, die Dohnanyi zu dieser Frage entwickelt, sind erfreulicherweise weniger vordergründig und einseitig als seine Russlandanalysen. Hier ermöglichen die Erfahrungen eines langen Politikerlebens vielfältige und interessante Einblicke. Dohnanyi sieht die aktuelle Verfassung der EU durchaus kritisch – zu viel Zentralismus, zu viel Bürokratie. In einer „ever closer union“ und der damit verbundenen Verlagerung von Kompetenzen aus den Nationalstaaten nach Brüssel sieht er keine gute Perspektive, auch nicht in der zuerst von Joschka Fischer formulierten Vision einer europäischen Föderation, also eines Bundesstaates, der an die Stelle des bisherigen Staatenbundes tritt. Dohnanyi sieht sich mit der Vision eines „Europas der Vaterländer“ eher in der Tradition von Charles de Gaulle. Die Nationalstaaten seien die politische Ebene, die am ehesten gesellschaftlichen Zusammenhalt und demokratische Legitimation gewährleisten kann. Deshalb solle man sie stärken und ihre Entscheidungsspielräume erhalten und wieder herstellen, wo sie durch Europarecht allzu sehr eingeengt seien.
Das sei etwa im Wettbewerbsrecht der Fall, wo die EU viel zu oft sinnvolle Unternehmensfusionen durchkreuze. Es gelte auch für die Frage, wie Mitgliedstaaten innerhalb der EU Rechtsstaatlichkeit und Demokratie auslegen. Wenn Polen einen Disziplinarhof für Richter einführen will und damit die Unabhängigkeit der Justiz einschränkt, solle man es gewähren lassen, so Dohnany mehr oder weniger unverblümt. Jedes Land habe nun mal seine eigenen Erfahrungen und seine besondere Kultur, da sei Vielfalt in fast jeder Hinsicht besser als strikte Europanormen. Hier muss man als Leser doch ein wenig die Stirn runzeln. Denn Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zur Disposition zu stellen, würde doch an die Wurzeln des Europaverständnisses gehen, wie wir es kennen.
Interessant ist Dohnanyis Vorschlag, statt einer mehr oder weniger offenen fiskalischen Transferunion Verfahren der geordneten Staatsinsolvenz einzuführen. Das stärke die Eigenverantwortung und damit nationale Selbstbestimmung.
Dohnanyi beschwört die Kooperation souveräner Nationalstaaten als Weg für ein starkes, gemeinsames Auftreten von Europa in der Welt. Ist das realistisch? Ist es nicht ein Paradox, ein starkes Europa, das den imperialen Strategien Amerikas, Russlands und Chinas etwas entgegensetzen kann, zu fordern und gleichzeitig die Übertragung von Souveränität von den Nationalstaaten auf Europa abzulehnen? Dohnanyi stellt sich diesen Fragen nicht so richtig. Auch geht er kaum auf die Frage einer gemeinsamen europäischen Verteidigung ein. Die für die Zukunft wichtigen Fragen des sozialen Ausgleichs und einer Sozialunion lässt er ebenso beiseite wie Fragen einer gemeinsamen europäischen Migrations- und Flüchtlingspolitik. Ganz Sozialdemokrat alter Schule ist Dohnanyi, wenn er eine entschiedenere staatliche Industriepolitik in Europa fordert. Auch hier könnte er einen Punkt haben, auch wenn es neben Airbus bisher nicht allzu viele Erfolgsgeschichten der Industriepolitik in Europa gibt. Bei Mikroelektronik und „grünen“ Technologien ist ein neuer Anlauf notwendig. Das ist unbestritten.
Dohnanyis „Nationale Interessen“ überzeugen in manchen Punkten durch nüchterne Analyse und politischen Realismus. Wichtig ist sein Hinweis auf die Tatsache, dass der Nationalstaat nach wie vor unüberholt ist, was die Fähigkeit zur Gewährleistung gesellschaftlichen Zusammenhalts und sozialen Ausgleichs angeht. Die Corona-Krise hat dies erst jüngst eindrucksvoll bestätigt. Dohnanyi zieht aus dieser Einsicht allerdings nicht unbedingt die richtigen Schlüsse, wenn er vorschlägt, nationalen Interessen konsequenterweise absoluten Vorrang zu geben und transnationale Verflechtungen, ob nun NATO, Währungsunion oder anderes, zu begrenzen oder gar zurückzufahren. Er steht hier den Positionen eines linken Neo-Nationalismus nahe, wie er etwa von Oskar Lafontaine, Sarah Wagenknecht und in der Wissenschaft von Wolfgang Streeck seit vielen Jahren vertreten wird. Dieser Neo-Nationalismus verkennt, wie stark gerade Deutschland von globalen Märkten, internationaler Zusammenarbeit und der Verlässlichkeit transnationaler Institutionen abhängig ist. Er verkennt auch die Bedeutung der Westeinbindung Deutschlands für den Erhalt von Freiheit und Demokratie und nicht zuletzt nährt er in Europa und Amerika Misstrauen in die Motive und die Verlässlichkeit deutscher Politik. Nicht Neo-Nationalismus, sondern der Einsatz für ein starkes und einiges Europa liegt im nationalen Interesse Deutschlands.
Grundlage dafür ist nicht ein naiver Internationalismus, sondern die nüchterne Einsicht, dass die Nationalstaaten des Kontinents für sich genommen zu klein und zu schwach sind, um sich alleine den geopolitischen Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft zu stellen. Es braucht etwas Drittes und das kann nur eine weiter entwickelte Europäische Union sein. Man kann nicht beides haben, ein starkes Europa und Nationalstaaten mit uneingeschränkter Souveränität. Hier ist Dohnanyis Ansatz leider nicht auf der Höhe der Zeit.
Was die russische Frage angeht, bleiben Dohnanyis Ausführungen in einer ärgerlichen Form den Fehlurteilen von Egon Bahr, Oskar Lafontaine und Gerhard Schröder verhaftet. Zugutehalten kann man dem Autor hier nur den Erkenntnisstand vor der russischen Invasion der Ukraine. Er war in Bezug auf die Bereitschaft Russlands, seine Interessen rücksichtslos durchzusetzen, wie viele andere in seiner Partei befangen von Wunschdenken und Illusionen. Was Europa angeht, gibt er interessante Denkanstöße, lässt aber wichtige Fragen unbeantwortet. Es bleibt offen, wie sich Deutschland und Europa aus der misslichen Abhängigkeit von den USA befreien können, ohne entweder schlicht zerrieben zu werden oder aber in neue Abhängigkeit von wesentlich weniger freundlichen Hegemons zu geraten als es die USA immer noch sind.
