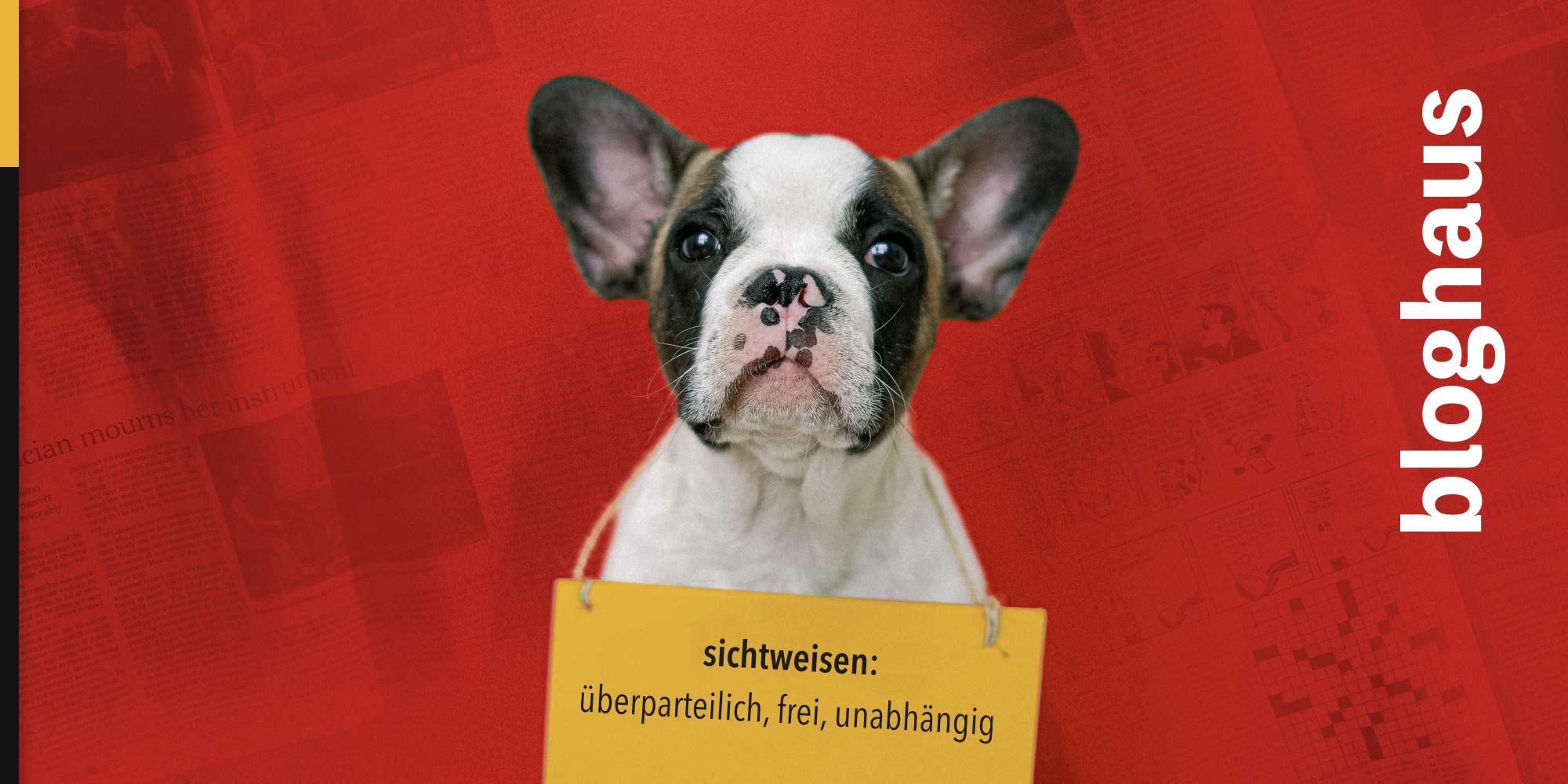– Wie man der AfD vielleicht doch noch beikommen kann –
Was tun gegen Populismus? Was tun gegen die AfD? Kaum eine Frage beschäftigt Politiker von SPD, CDU und anderen etablierten Parteien mehr. Und bei kaum einer Frage ist man dennoch so ratlos. Die bisherigen Strategien jedenfalls sind offenkundig gescheitert. Da ist zum einen der Versuch, die Themen der AfD zu übernehmen und ihr mit eigenen Zuspitzungen, etwa beim Thema Migration, den Wind aus den Segeln zu nehmen, vor militanten Besitzstandswahrern wie den Landwirten zurückzuweichen und im Bereich der Klimapolitik den Rückwärtsgang einzulegen, um Wohlstandsängste in der Bevölkerung zu beruhigen. So machen es CDU und CSU.
Zur anderen Gruppe der bisher gescheiterten Versuche einer Einhegung der AfD gehört eine expansive Sozialpolitik, die mit Milliardenausgaben bei Rente und Bürgergeld die Gemüter zu beruhigen und die Wählerinnen und Wähler mit dem Versprechen sozialer Sicherheit von den rechten Verführern wegzulocken versucht.
Schließlich muss man wohl auch all die teuren Programme wie „Demokratie stärken“ als eher erfolglos ansehen, die es mit Aufklärung, dem Beschwören von Vielfalt und Toleranz und mit allen möglichen kulturellen Aktivitäten versuchen, oft allerdings gepaart mit einem recht engen Verständnis von dem, was man als demokratieverträgliche Haltungen und Meinungen ansieht.
All das hat nicht funktioniert, wie die steigenden Beliebtheitswerte der AfD zeigen, bisher zumindest. Dabei ist es sicher nur ein schwacher Trost, dass man in Deutschland mit der Hilflosigkeit gegenüber dem Rechtspopulismus nicht allein steht in Europa. In den meisten Ländern haben sich starke Parteien am rechten Rand etabliert, in einigen Ländern haben sie es sogar in die Regierungen geschafft.
Vielleicht stimmen einfach die Prämissen der Politik „gegen rechts“, vielleicht stimmt die zugrunde liegende Analyse nicht. Einigermaßen gesichert ist, dass es keine beziehungsweise keine auffällige Beziehung zwischen Armut und einer Präferenz für die AfD gibt. Das von der SPD und Linken, aber auch von Wohlfahrtsverbänden und der Soziallobby gerne verbreitete Narrativ, dass „Hartz 4“ zum Rechtsruck beigetragen hat, ist, das kann man einigermaßen gesichert sagen, falsifiziert. Es gibt keine auffälligen statistischen Zusammenhänge von hohen Armutsraten und AfD-Zustimmung.
ie AfD-Hochburg Thüringen zum Beispiel ist keineswegs ein Landstrich im Niedergang. Vielmehr zeigen alle sozioökonomischen Indikatoren, von der Hartz-IV-Quote über Arbeitslosigkeit bis hin zur Beschäftigungsentwicklung eine regelrechte Erfolgsstory über die letzten 25 Jahre, auf die manche westdeutschen Bundesländer nur neidvoll blicken können.
Auch bei kleinräumigen Wahlanalysen in westdeutschen Städten zeigt sich die AfD ist keineswegs dort stark, wo es viele Transferleistungsbezieher gibt, sondern eher in kleinbürgerlichen Quartieren. Die beiden „Zeit“-Journalisten Julius Kölzer und Mark Schieritz zitieren aus einer Umfrage des Leibniz-Instituts für Sozialwissenschaften in Mannheim Befunde, dass AfD-Wähler dem Sozialstaat insgesamt sogar eher kritisch gegenüberstehen. Eine Ausweitung von Sozialleistungen wünschen sie ausdrücklich nicht. Wenn Menschen in Armut fallen, sei es wohl vielfach auch selbstverschuldet. Die Gesellschaft habe da nur sehr begrenzte Pflichten zur Unterstützung, zumal soziale Transferleistungen ja zunehmend eher Migranten zugutekommen als der autochthonen, eingesessenen Bevölkerung.
Auch soziale Ungleichheiten beunruhigen AfD-Wähler scheinbar eher weniger als den Rest der Bevölkerung. Andere sozialwissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass Wähler rechtspopulistischer Parteien mit sozialen Ungleichheiten sogar eher positive Gedanken verbinden, insoweit zumindest, als sie in einer Besserstellung der eigenen Lage gegenüber Unterschichten und eben auch der migrantischen Bevölkerung einen Ausdruck von Gerechtigkeit sehen. Schließlich seien es die „Normalos“ aus der Mittelschicht, die den Laden der Gesellschaft am Laufen halten. Auch die hätten es nicht immer einfach. Nicht zuletzt waren sie schon da, als all die anderen erst neu ins Land kamen, haben also ältere Rechte, die ihnen nun in ihren Augen mit der Transformation in eine Zuwanderungsgesellschaft genommen werden sollen.
Angst macht in den Mittelschichten heute auch der drohende Verlust des Abstands nach unten und die Gefährdung des erreichten Wohlstands durch Inflation und wirtschaftlichen Wandel. In der Tat haben viele Untersuchungen zum Wohlbefinden von Menschen bestätigt, dass es dabei mehr auf die Relation der eigenen Position zu der anderer ankommt als auf das absolute Niveau der materiellen Ausstattung. Wenn in einer Gesellschaft aufgrund des wirtschaftlichen und demographischen Wandels neue Gruppen nach oben drängen und bestehende soziale Rangpositionen gefährdet sind, erzeugt das Abwehrreaktionen. Die zurzeit mächtigste darunter ist sicher der Rechtspopulismus.
Die Soziologen Norbert Elias und John L. Scotson haben in der inzwischen als Klassiker angesehenen Studie „Etablierte und Außenseiter“ in einem wachsenden Vorort einer englischen Stadt schon in den 1960er Jahren gezeigt, wie sich die Ängste vor Statusverlusten zu einem gefährlichen Gemisch von Vorurteilen und Ausgrenzung verwandeln können, wenn eine große Zahl von Neuankömmlingen die alte Ordnung in Frage stellt. Es lohnt sich durchaus, diesen Klassiker der Soziologie noch mal vom Regal zu holen, wenn man die aktuelle Spaltungsdynamik in der Gesellschaft verstehen will.
Auch der Wandel des Migrationsbildes mag dazu beitragen, gibt es doch immer mehr migrantische Aufsteiger, die sich durch Fleiß, Talent, nicht zuletzt auch durch funktionierende familiäre Netzwerke in höhere Einkommensregionen vorarbeiten und die ihnen im klassischen Gastarbeiterklischee zugedachte Rolle der unteren Hilfsklasse verlassen. Das Konzept der „postmigrantischen Gesellschaft“ weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Aufstiegsprozesse in großen Teilen der migrantischen Bevölkerung nicht unbedingt mit einer Anpassung an kulturelle Normen der Gastgesellschaft verbunden sind, sondern auch in der dritten und vierten Migrantengeneration in immer mehr Fällen eher mit einem selbstbewussten Ausleben von kultureller Differenz. Dadurch entstehen neue Konfliktlinien in der Mitte der Gesellschaft und Ängste der Alteingesessenen, irgendwann nicht mehr Mehrheit zu sein, sondern auch nur eine Gruppe unter anderen und möglicherweise wirtschaftlich weniger erfolgreich. Vertreter des „postmigrantischen“ Konzepts wie Mark Terkessides und Naika Foroutan sprechen deshalb auch von einem „Integrationsparadox“ und prognostizieren ein eher steigendes gesellschaftliches Konfliktniveau trotz erfolgreicher Integration in sozioökonomischen Kategorien wie Beschäftigung und Einkommen.
Wenn man sich Sorgen über den gesellschaftlichen Zusammenhalt macht, sollte man also den kulturellen Faktor nicht außen vorlassen. Nicht auszuschließen, dass es die wahrgenommene Schwäche der Mehrheitsgesellschaft und ihrer Institutionen in dieser Dimension ist, die die Sehnsucht nach mehr „klarer Kante“ auch in kulturellen Fragen befeuert. Allzu sehr hat man sich in dieser Sichtweise der Feier einer weitgehend unhinterfragten „Diversität“ hingegeben und sich in defensive Positionen und Selbstbezichtigungsdiskurse mit einem kreativ aufgefächerten „Rassismus“-Begriff mit entsprechenden Dauervorwürfen einschnüren lassen.
Mit einem großzügigen Bürgergeld wird man im rechten Meinungsspektrum also nicht punkten können, offenbar auch nicht mit auf Umverteilung setzender Sozialpolitik in anderen Feldern. Was „Rechte“ umtreibt, ist weniger das tatsächliche Versorgungsniveau, sondern die Einhaltung von sozialen Abständen und die Sicherung der eigenen Position, auch und gerade, wenn man diese in Bezug auf andere noch als privilegiert wahrnimmt. Gerecht ist in diesem Sinne, was Abstände sichert. Und das steht nun mal in diametralem Gegensatz zu einem universalistischen Gerechtigkeitsverständnis, nach dem, frei nach Immanuel Kant in seiner „Grundlegung der Metaphysik der Sitten“, jeder Mensch und jedes vernunftbegabte Wesen nicht nur als Mittel, sondern auch als Zweck an sich selbst zu behandeln ist. Die Debatte um das Bürgergeld zeigt zwar auch, dass eine solche Maxime leichter formuliert als in konkrete Politik umgesetzt ist. Allzu großzügige Leistungen können falsche Anreize setzen und die Integration in den Arbeitsmarkt erschweren.
Der Missbrauch von Sozialleistungen ist nichts, was leichthin abzutun ist. Viele haben angesichts von Berichten von ausländischen Clans, die den Sozialstaat rücksichtslos ausnutzen das Gefühl, dass der Staat diesem Treiben schon allzu lange hilflos zuschaut. Handelsblatt-Redakteur Christian Ricken sprach gar von einem „AfD-Moment“, der ihn ergreife, wenn er von organisierten Netzwerken von Menschen aus Sodosteuropa lese, die nach Deutschland kommen, um das Bürgergeld auszunutzen und damit Geschäfte zu machen, der Staat dem aber immer noch hilflos zusehe.
Aber das ändert nichts daran, dass man in einem universalistischen Gerechtigkeitskonzept, Solidarität weit fasst und die Gesellschaft als eine Veranstaltung versteht, die integriert und nicht ausgrenzt. Das sehen „Rechte“ anders. Und auch auf der Linken ist man vor Sozialchauvinismus nie gefeit. Sarah Wagenknecht und andere spielen schon ganz gerne mal deutsche Renten und das Bürgergeld gegen die Hilfe für die von Russland angegriffene Ukraine aus. Dass inzwischen fast 50 Prozent der Leistungsberechtigten im Bürgergeld keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, ist für manche ein Grund darüber nachzudenken, diesen die Leistung zu verweigern oder die Hürden bei der Beantragung deutlich zu erhöhen. Auch dafür mag es Argumente geben. Mehr Sinn würde es aber machen, das Bürgergeld stärker auf die Aufgabe der Integration in die deutsche Gesellschaft auszurichten, durchaus im Sinne von energischem Fordern, aber eben auch im Sinne von zielorientiertem und passgenauem Fördern.
In der Sozialpolitik wird man ebenso wenig wie in der Innen- und Migrationspolitik gegen eine erfolgreiche AfD gewinnen, wenn man sich deren Mindset von Chauvinismus und Ausgrenzung anpasst oder auch nur den Eindruck erweckt, man sei hier eingeknickt. Die Wähler erkennen den Trick und entscheiden sich dann doch fürs Original, was man durchaus als rationales Verhalten betrachten kann, denn die Wende der anderen Partei zeigt ja nur, dass man es mit der Stimme für die AfD richtig gemacht und die Puppen zum Tanzen gebracht hat. Und was die Schärfe der Forderungen nach Ausgrenzung und skrupellosem Chauvinismus angeht, wird die AfD immer einen Schritt weiter gehen, egal wie weit man ihr nach rechts entgegenkommt.
Vielleicht bringt es mehr, wenn die Politik sich darauf besinnt, zunächst einmal dafür zu sorgen, dass der Staat auf allen seinen Ebenen funktioniert, dass Sozialmissbrauch nicht nur beklagt, sondern entschieden bekämpft wird (die Stadt Offenbach zum Beispiel hat in diesem Bereich durchaus nachhaltige Erfolge erzielen können), dass Brücken nicht einstürzen oder gesperrt werden müssen, dass Züge und Busse pünktlich fahren, die Kinderbetreuung funktioniert, die Schulen in Schuss sind und dass die Verwaltung funktioniert. Dafür müsste man sich auf die wirklichen Kernfunktionen des Staates und der Verwaltung besinnen und die Ressourcen dort konzentrieren. Ein ausuferndes Beauftragtenwesen und wuchernde minderheitspolitische Sub-Agenden konterkarieren den notwendigen Willen zum funktionierenden Staat, auch den Willen zum funktionierenden Sozialstaat, eher als dass sie ihn unterstreichen. Auf die Kernfunktionen der Daseinsvorsorge kommt es an.
Wenn beim Staatsunternehmen Deutsche Bahn, wie man in der Presse lesen konnte, die Ziele Frauen in Führungspositionen zu bringen und den Betrieb CO2-neutral zu machen bei der Berechnung der Vorstandsboni höher gewichtet werden als die Ziele von Pünktlichkeit und Kundenzufriedenheit, stimmt etwas mit dem Koordinatensystem der Politik nicht, die in diesem Konzern nach wie vor das Sagen hat. Der Wille zum funktionierenden Staat zeigt sich darin, dass die Politik wenige, klare Prioritäten setzt und diese dann aber sehr konsequent umsetzt. Ein Staat, der sich permanent überfordert, wird alle enttäuschen und, besonders schlimm, ein Bild von Machtlosigkeit und Gestaltungsunfähigkeit produzieren, das die Bürger nicht nur an seiner Funktionsfähigkeit, sondern mehr und mehr am Sinn von Demokratie überhaupt zweifeln lässt. Die große Koalition in Berlin hat es in der Hand, mit den anstehenden Reformen Zeichen zu setzen. Allzu viele Patronen hat sie dabei nicht mehr im Gewehr. Der Schuss muss sitzen, um im Bild zu bleiben. Wenn die Politik hier scheitert, könnte sie ihre letzte Chance für die Sicherung der Demokratie im Land vertan haben.