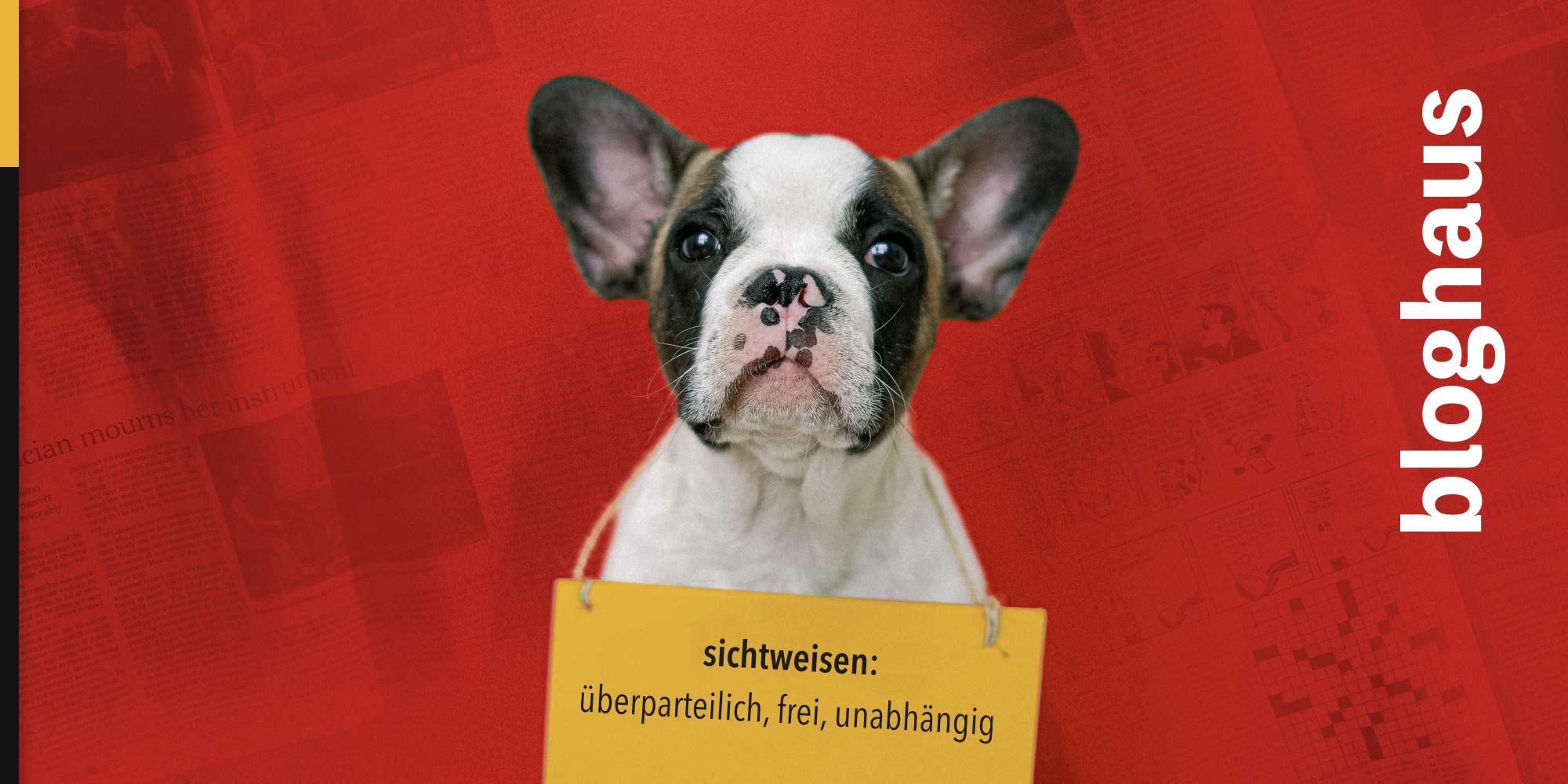– Der Rechtsstaat muss vor dem Kollabieren gerettet werden –
Ein Hoch auf Justitia, die römische Göttin der Gerechtigkeit. Ein Hoch auf die mit ihr verknüpften Symbole, damit Recht ohne Ansehen der Person (Augenbinde), nach sorgfältiger Abwägung der Sachlage (Waage) gesprochen und schließlich mit der nötigen Härte (Richtschwert) durchgesetzt wird. Nun hat die vom Staat durch dessen Gesetze geführte Rechtsprechung jeweils ihre Zeit und mit dem ethischen Ideal von Gerechtigkeit recht wenig zu tun. So betrachtete das römische Recht die Sklaverei als selbstverständlich, legitimierte die NS-Justiz skrupelloseste Verbrechen und wurde Alexei Nawalny in Moskau rechtskräftig verurteilt, um nur einige Auswüchse zu nennen. Hierzulande orientiert sich das Recht zwar am Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung, wacht aber nur darüber, dass die Regeln eingehalten werden, die die Gesellschaft zusammenhalten. Was aber, wenn die Justiz diese Regeln nicht immer durchsetzen kann, weil der Rechtsstaat durch die verschiedensten Faktoren überfordert ist? Den Strafverfolgern fehlt es an allen Ecken und Enden an Ausstattung und Geld, um ihrem Auftrag entsprechend handeln zu können. Die aus TV-Krimiserien gewohnte DNA-Analyse über Nacht zieht sich in der Realität schon mal über Wochen hin. Rechtsbrecher machen sich über gewiefte Verteidiger lange Verfahrensdauern zu Nutze, Vollzugsdefizite führen dazu, das Gesetze und Verordnungen nur symbolischen Charakter haben. Justitia geht demnach wohl eher am Stock, statt sich auf das Schwert zu stützen. Wieviel ist das Recht da noch wert? Der Versuch eines Einstiegs in ein vielschichtiges Thema…
Kristof F. wird von der Justiz im Stich gelassen. Der junge Familienvater will gerichtlich festhalten, dass das Wasser in dem Keller seiner Doppelhaushälfte das Resultat von Umbaumaßnahmen des Nachbarn ist, der Wasch- Toiletten- und Duschgelegenheiten nachträglich in seinem Keller eingebaut hat. Einbau und Wassereinbruch passen zeitlich zueinander. Mit seiner Anwältin stößt F. ein sogenanntes Beweissicherungsverfahren beim Amtsgericht an. Das war vor sechs Jahren. Abgeschlossen ist es bis heute nicht. Immerhin sieht es derzeit so aus, als würde das jüngste vom Gericht bestellte Gutachten zur Klärung von Beweisen im Rahmen eines Prozesses zugelassen. Die Folgen der Verzögerung: F. durfte seine Schäden (und damit Beweise) bisher nicht beseitigen. Seine Familie muss deshalb seit sechs Jahren mit dem ständig wiederkehrenden Wasser im Keller und den schimmeligen Folgen leben. Notgedrungen haben sie ihren Keller vom Familienleben abgetrennt. Dennoch stinkt´s im ganzen Haus mal mehr oder weniger streng.
Für die Dauer dieses unhaltbaren Zustands sind neben in diesem Fall inkompetenten Gutachtern auch die Probleme der deutschen Justiz ursächlich, die sich in zu langer Verfahrensdauer wegen von ihr beklagten Personalmangels, Prozesse verschleppender Verfahrensordnungen und ausbleibender Digitalisierung bei gleichzeitig immer mehr zu bearbeitenden Fällen in einem immer komplizierteren juristischen Umfeld zusammenfassen lassen. Ewig lange Wartezeiten auf Erbscheine oder Eintragungen in Grundbuch oder Handelsregister sind für die Öffentlichkeit ebenso augenscheinliche Auswirkungen der Misere wie schlagzeilenträchtige Entlassungen von Untersuchungshäftlingen wegen der Überschreitung von Fristen.
Pakt für den Rechtsstaat
Die Justiz steht vor dem Kollaps, sagt sogar der Deutsche Richterbund (DRB), der deshalb vor der jüngsten Justizministerkonferenz ein entschlossenes Handeln hin zu dem im Koalitionsvertrag festgehaltenen „Pakt für den Rechtsstaat forderte“. Der Titel lässt Schlimmes erahnen: Der Rechtsstaat muss offensichtlich gerettet werden. Nach dem Beschluss der Konferenz soll die Justiz zukunftsfest aufgestellt werden, durch verbesserte Digitalisierung, beschleunigte Verfahren und eine nachhaltige personelle Stärkung. Vorgesehen ist eine langfristige Mitfinanzierung von mindestens 2.000 zusätzlichen Stellen für Richter- und Staatsanwaltschaften sowie den Geschäftsstellendienst. Doch selbst wenn das Geld letztlich bereitsteht, bleibt immer noch die Frage: Was soll das bringen, da jetzt schon die Bewerber fehlen?
Über die aktuelle Digitalisierungsinitiative hinaus hält die Länderrunde eine jährliche Bundesbeteiligung von mindestens 200 Millionen Euro für erforderlich. „Wir fordern den Bund auf, mit einem neuen Pakt jetzt zügig die Weichen für eine nachhaltige Stärkung des Rechtsstaats zu stellen“, heißt es. Dazu gehöre eine angemessene Finanzierung und die weitere Digitalisierungsoffensive. Auch der Bund trage Verantwortung für den gemeinsamen Rechtsstaat in Deutschland, heißt es. Die Digitalisierung soll speziell auch im Strafprozess vorangetrieben werden. In dieser Hinsicht drängen die Länder auf eine Reform des Strafverfahrensrechts. Insbesondere bei der Erfassung, Verarbeitung und Einführung digitaler Beweismittel bestehe Bedarf nach Optimierung. Dazu gehöre etwa die Schaffung eines rechtlichen Rahmens für den Betrieb einer Beweismittelcloud von Polizei und Justiz.
Diese Beschlüsse sollen also jetzt den vom Richterbund befürchteten Kollaps der Justiz verhindern helfen, der sich in der Überlastung von Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichten ankündigt. Skepsis ist angebracht, vor allem weil der Personalengpass auf diesem Weg nicht gelöst werden kann.
Kaum Ressourcen
Die tiefgreifenden Probleme sind größtenteils struktureller Art: Bis 2030 gehen bundesweit 40 Prozent der Richter und Staatsanwälte in Pension. Wie lässt sich dagegenhalten, wo doch verbesserungswürdige Arbeitsbedingungen und im Vergleich zur Wirtschaft schlechtere Bezahlung das Feld qualifizierter Bewerber immer weiter schrumpfen lässt? Schon die EU-Kommission rügte Deutschland dafür, dass es seine Richter und Staatsanwälte zu schlecht bezahle. Deutschland müsse sich mehr anstrengen, um „angemessene Ressourcen“ für die Justiz sicherzustellen, heißt es in dem Report.
Ein paar Zahlen zur Verdeutlichung: Der Gehaltsunterschied zwischen Justiz und Unternehmen beträgt heute etwa 40.000 Euro im Schnitt. Noch deutlicher fällt der Abstand zur Großkanzlei aus: Dort beträgt der Vorsprung zum Justizeinstieg etwa 80.000 Euro. Für den Richterbund ist diese Entwicklung eine ernsthafte Bedrohung für die Attraktivität des öffentlichen Dienstes und die Nachwuchsgewinnung in der Justiz. Der Vorsitzende des niedersächsischen Richterbundes Frank Bornemann warnt derweil vor einseitigen Einstellungsoffensiven: „Wir sehen einen Stau bei den Staatsanwaltschaften; wenn dieser Stau beseitigt werden sollte, wird die Flutwelle bei den Gerichten ankommen“. Deshalb müssten auch die Strafkammern „massiv verstärkt“ werden. Bei der Finanzierung sieht Bornemann auch den Bund am Zug. Wenn der Bundestag Gesetzesverschärfung beschließe, könne es nicht allein Sache der Länder zu sein, mit Personal dafür zu sorgen, dass diese auch umgesetzt würden.
Es fehlen Ermittler, deshalb ziehen sich die Strafverfahren zunehmend in die Länge, müssen immer häufiger sogar eingestellt werden. In Berlin haben 2023 mehr als die Hälfte der Kriminellen damit rechnen können, für ihre Tat nicht juristisch belangt zu werden, sagt der Berliner Oberstaatsanwalt Ralph Knispel. Bundesweit mussten in jenem Jahr 61 dringend Tatverdächtige schwerer Vergehen aus der Untersuchungshaft entlassen werden, weil ihre Strafverfahren zu lange dauerten. Die Haftbefehle wurden aufgehoben. Die meisten Fälle gab es laut dem DRB in Sachsen (15), gefolgt von Hessen (11). Dabei geht es um Täter, denen (versuchter) Mord, Totschlag, Vergewaltigung, Raub, gefährliche Körperverletzung, Drogenhandel im großen Stil vorgeworfen wurde. Die Strafprozesse laufen zwar weiter, die Angeklagten sind währenddessen aber nicht mehr hinter Gittern, sondern wieder auf freiem Fuß. Hintergrund: Nach sechs Monaten müssen die Haftgründe eines Tatverdächtigen erneut überprüft werden. Über sechs Monate hinaus darf die Untersuchungshaft nur aufrechterhalten werden, wenn die besondere Schwierigkeit des Falls oder der besondere Umfang der Ermittlungen dies rechtfertigen. Sechs Monate sollten den Strafverfolgern unter normalen Umständen auch genügen, um zu einem abschließenden Urteil zu kommen. Doch konnte der Gesetzgeber bei der Festsetzung dieser Frist nicht ahnen, mit welchen Widrigkeiten die Strafverfolger von heute zu kämpfen haben.
DRB-Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn fordert „ein kraftvolles Sofortprogramm, um die Strafverfolgung zu beschleunigen und die Sicherheit im Land zu verbessern“. Die Strafjustiz dürfe nicht zum Flaschenhals der Kriminalitätsbekämpfung werden. Die jüngste Justizministerkonferenz hat darauf jedoch noch keine finale Antwort gefunden.
Die Crux mit der Digitalisierung
Auch im Bereich der Zivilgerichtsbarkeit bestehe dringender Handlungsbedarf, so Rebehn. Hier könne eine „durchdachte Digitalisierung“ dazu beitragen, Verfahren effizienter zu gestalten und der Bevölkerung schnelleren Zugang zu ihrem Recht zu ermöglichen. Speziell im Justizvollzug sieht man nach Erkenntnissen des Justizministeriums Baden-Württemberg vor allem Potential im verstärkten Einsatz moderner Systeme. Genannt werden unter anderem die „Digitalisierung der Pforte“, Kameraüberwachung, KI-basierte Strafzeitberechnung und die Einführung der elektronischen Aktenführung. Letzteres könnte gleichzeitig die Flexibilität der Arbeitszeiten – insbesondere durch die Möglichkeit von Homeoffice – fördern und so einem weiteren Anliegen der Justizbeamtinnen und -beamten begegnen.
Mit den Digitalisierungsanstrengungen im öffentlichen Bereich ist es aber so eine Sache. Weil jede Behörde ihr eigenes Süppchen kocht, gibt es immer wieder Knoten im System, welches ungewohnt oft auch nicht stabil läuft. Was forderte Richterbund-Geschäftsführer Rebehn noch gleich? Eine „durchdachte Digitalisierung“. Das lässt tief ins bisher von der öffentlichen Hand gestrickte digitale Netzwerk blicken, das laut Richtervereinigung Schleswig-Holstein „langsam und umständlich“ ist, „zu viele Zwischenschritte“ benötigt und mit einem „unübersichtlichen, unlogischen Aufbau nervt. „Wie soll ich einen Bürger erklären, dass wir mit der E-Akte arbeiten, er aber nichts per Mail einreichen darf“ lautet einer der Kommentare einer Umfrage unter 460 Mitarbeitenden der Richtervereinigung.
Der Württembergische Richterbund hat jüngst öffentlich Alarm geschlagen: „Wir haben bereits fast wöchentlich landesweite Ausfälle der IT-Systeme“, erklärte Verbandschef Michael Mack. Die Folge: Gerichte könnten ihre Aufgabe – Recht zu sprechen – nicht mehr erledigen. Offenbar fallen die Probleme unterschiedlich aus. Mal sind Geschäftsstellen an Amts- und Landgerichten wegen Computer-Pannen lahmgelegt, mal lassen sich einzelne Gerichtsakten nicht öffnen. Der Richterbund warnt vor einer Verschärfung der Probleme: Wenn jetzt – wie geplant – Arbeits-, Sozial- und Verwaltungsgerichte gemeinsam mit der Strafjustiz ebenfalls digitalisiert würden, drohe das IT-System der Justiz zusammenzubrechen, so Mack. Er forderte eine grundlegende Erneuerung. Die würde aber nur bei einer Planung aus einer Hand Sinn machen, ein schwieriges Unterfangen im föderalen Zuständigkeitsdickicht. So klappt der Datenaustausch mit Gerichten über die Landesgrenzen hinaus nur in vier Fällen ohne Probleme. Nur diese vier von 16 Bundesländern setzen aufs gleiche System.
Erste Rezepte gegen die Krise
Nach Angaben des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) zeigen die Statistiken der letzten Jahre einen deutlichen Rückgang der Eingangszahlen bei den Zivilgerichten, was zum einen auf die Zunahme außergerichtlicher Verfahren als Folge der letzten größeren Zivilprozessreform 2001, zum anderen aber auch auf die unzureichende Ausstattung und Kompetenz der Justiz zurückzuführen sei. Eine Expertenbefragung habe ergeben, dass wesentliche Gründe für den Rückgang der Eingangszahlen in Zivilsachen die mangelnde Spezialisierung der Gerichte und die weiterhin schleppende Digitalisierung der Justiz sei. Auf diese Entwicklung an den Amtsgerichten will das Bundesministerium der Justiz unter Stefanie Hubig (SPD) nun mit einer Erhöhung der Streitwertgrenzen von bisher 5.000 auf 10.000 Euro reagieren. Wie das Online-Magazin für Juristen Legal Tribune Online (LTO) berichtet, sollen zusätzlich auch Streitigkeiten im Bereich des Nachbarrechts generell in die Zuständigkeit der Amtsgerichte fallen, also unabhängig davon, wie hoch der Streitwert des Verfahrens ist. Andere Rechtsstreitigkeiten im Arzthaftungsrecht, Presserecht oder Vergaberecht sollen dafür generell den Landgerichten zugewiesen werden, um so eine weitere Spezialisierung der Justiz zu fördern. Die Verfahrenseingänge bei den Amtsgerichten würden laut Justizministerium bundesweit um 65.000 Verfahren pro Jahr zunehmen, Bei den Landgerichten dagegen würden jährlich etwa 58.000 und bei den Oberlandesgerichten rund 14.000 Verfahren weniger Verfahren eingehen.
Für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist aus Sicht des IW das oftmals fehlende Verständnis von Richtern über komplexe wirtschaftliche Zusammenhänge ein Problem. Der Grund dafür liege im veralteten Ausbildungssystem, das auf eine generalistische Ausbildung setzt und anders als in den USA keine ökonomische Kompetenzbildung einschließe. Die Zivilprozessordnung brauche keine grundlegende Reform, doch fehle es an der Schulung der Richter, den Spielraum etwa für den Einsatz von Schiedspersonen zu nutzen. Auch der Übergang zu einem dreistufigen Gerichtssystem mit der Einrichtung von Fachkammern anstelle einer eigenen Fachgerichtsbarkeit könnte Ressourcen bündeln und Synergien schaffen, ist sich das Wirtschaftsinstitut sicher.
Besserung könnten die seit 2020 zunächst in Baden-Württemberg eingerichteten Commercial Courts bringen, die nach und nach von anderen Bundesländern übernommen werden. Diese, speziell auf Unternehmensfälle spezialisierten Kammern an Land- und Oberlandesgerichten, sollen eine Alternative zu bisher dominierenden Schiedsverfahren bei Unternehmensstreitigkeiten sowie zu ausländischen Handelsgerichtskammern darstellen (Quelle: EY, 2024). Spezialisierte Richter und die Möglichkeit einer englischsprachigen Verhandlung erweiterten den bisherigen Rahmen deutlich, heißt es. Doch könne bisher jedes Bundesland selbst über die Einrichtung und die Sachbereiche entscheiden, so dass ein „Flickenteppich“ mit zusätzlicher Bürokratie drohe.
Sachsen hat der Justizministerkonferenz vorgeschlagen, dass strafrechtliche Revisionsverfahren künftig grundsätzlich im Beschlusswege ohne Hauptverhandlung entschieden werden können. Ob eine Hauptverhandlung durchgeführt wird, solle fortan allein von deren Zweckmäßigkeit nach Einschätzung der Gerichte abhängen. Dadurch würde gesetzlich nachvollzogen, was bereits überwiegend der Praxis am Bundesgerichtshof entspräche. Außerdem könnten auf diese Weise – ohne Abstriche bei der Qualität revisionsrechtlicher Entscheidungen – Ressourcen der Justiz und der Anwaltschaft geschont, Verfahren beschleunigt und die Justizhaushalte von Bund und Ländern entlastet werden.
Verfahren vor Gericht sollen beschleunigt werden, die Verfahrensdauer sinken. Dazu ist geplant, den Zugang zur zweiten Tatsacheninstanz zu begrenzen. Zudem sollen neue Rechtsgrundlagen geschaffen werden, etwa Vorgaben zur Strukturierung des Parteivortrags. Für die Modernisierung der Zivilprozessordnung soll auf Vorarbeiten der Reformkommission „Zivilprozess der Zukunft“ zurückgegriffen werden.
Auch das Strafprozessrecht soll überarbeitet werden. Details soll eine Kommission erarbeiten. Die Verwaltungsgerichtsordnung soll reformiert und verstärkt Einzelrichter zum Einsatz kommen können sowie die Einführung von Pilotverfahren geprüft werden. „Verwaltungsgerichte sollen sich unter Beibehaltung des Amtsermittlungsgrundsatzes künftig stärker auf den vorgebrachten Parteivortrag und auf eine Rechtmäßigkeitsprüfung konzentrieren“, heißt es in dem Papier.
Was diese Ankündigungen dann konkret heißen werden, vor allem wie sehr sich etwa die Länder bei dem Stellenzuwachs finanziell beteiligen müssen oder was die Nutzung von KI in der Justiz genau bedeuten kann, dazu findet sich in dem Papier noch nicht viel. Es legt aber auch erst einmal nur die großen Leitlinien fest. Deutlich wird jedenfalls, dass im Gesamtkonzept für einen „leistungsfähigen Staat“ eine „zuverlässige“ Justiz eine wichtige Rolle spielt.
Die dritte Gewalt
Außerdem enthält das Dokument der Justizministerkonferenz ein Bekenntnis zur Stärkung des Rechtsstaats in der Gesellschaft. Das soll mit einer Stärkung der Bundeszentrale für politische Bildung und Fortführung der in Karlsruhe und Leipzig agierenden Stiftung Forum Recht einhergehen. Die Beschäftigung mit der Frage, wie die Justiz Bürgerinnen und Bürger die zentrale Bedeutung der dritten Gewalt im Staat gerade in Zeiten vermitteln kann, in denen andere Staaten politische Kräfte erleben, die sich über Recht und Gesetz hinwegsetzen und die Justiz angreifen, berührt auch Aspekte der Absicherung einer unabhängigen Justiz in der Demokratie. Die Resilienz des Rechtsstaats muss auf allen staatlichen Ebenen gestärkt werden. Der verbesserte Schutz des Bundesverfassungsgerichts vor gezielten politischen Eingriffen kann auf diesem Weg nur ein erster Schritt gewesen sein.
Der Richterbund fordert schon lange, die Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften zu stärken und das ministerielle Weisungsrecht nach § 146 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) abzuschaffen. Die Justizminister sollten ihre „aus dem vorletzten Jahrhundert stammenden Durchgriffsrechte“ endlich aufgeben. Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn: „Allein der böse Anschein, dass Minister Strafverfahren aus dem Hintergrund politisch steuern könnten, erschüttert das Vertrauen in eine objektive und nur den Gesetzen verpflichtete Strafverfolgung.“ In der vergangenen Wahlperiode hatte Justizminister Marco Buschmann einen Entwurf vorgelegt, mit dem das Weisungsrecht in enge rechtliche Bahnen gelenkt und transparenter werden sollte. Laut Rebehn räumt der Gesetzentwurf nicht die Bedenken der EU-Kommission und des Europäischen Gerichtshofes aus, die „deutsche Staatsanwälte wegen ihrer Weisungsabhängigkeit nicht als unabhängige Justizbehörde anerkennen“. Deutlich zielführender als Buschmanns Vorschlag sei ein Reformmodell aus Nordrhein-Westfalen, wonach entsprechende Weisungen auf Fälle fehlerhafter Rechtsanwendung beschränkt werden sollen. Damit würde etwaigen Durchgriffsversuchen auf die zuständigen Staatsanwälte und allen Spekulationen darüber von vornherein der Boden entzogen.
Es wird immer klarer, dass es auch in den Bundesländern Initiativen braucht, um den Rechtsstaat wetterfest zu machen und die Unabhängigkeit der Justiz gegen mögliche Durchgriffsversuche illiberaler Kräfte zu sichern. Die Resilienz der Landesverfassungsgerichte sowie die Frage, wer wie über die personelle Besetzung der Justiz zu entscheiden hat, gehören mit Priorität auf die politische Agenda. Das Verfahren zur Besetzung von Richterstellen ist so auszugestalten, dass es nicht parteipolitisch instrumentalisiert werden kann. Um das zu gewährleisten, braucht es vor allem starke Mitbestimmungsrechte der Justiz bei Einstellungen und Beförderungen.
Grundsätzliches
Die Judikative in Deutschland ist mit Ausnahme des Bundesverfassungsgerichts eine Behörde der Exekutive. Eine 3. Staatsgewalt besteht in Deutschland ausschließlich in Form der Weisungsfreiheit des Richters im konkreten Urteil. Darüber hinaus gibt es genau genommen keine 3. Gewalt, weil alles über die Exekutive (siehe Durchgriffsrechte) läuft. Die Judikative erhält in Deutschland das, was die Exekutive für sie bereitstellt. Wenn die (Landes-)Regierung mehr Geld für ihr Lieblingsprojekt braucht, kann sie problemlos Mittel bei der Judikativen zusammenstreichen. Was sie auch regelmäßig tut. Die Judikative kann nicht mal ihren eigenen Wunschbedarf formulieren. Es fehlt jegliche Form von Selbstverwaltungsorgan, die auch nur die Formulierung eines Wunsches ermöglichen würde. Die deutsche Justiz hängt sowohl von den Mitteln als auch von der Verwaltung her am Tropf der Exekutive. Reformen sind überfällig. Denn Unabhängigkeit ist nur gegeben, wenn genug Geld vorhanden ist, um den Auftrag zu erfüllen, und sich die Qualität der Erfüllung des Auftrages nicht nach den verfügbaren Mitteln richtet. Vor allem ein Rechtsstaat sollte nicht an seinen Gerichten sparen.
Titelfoto: Thorben Wengert / Pixelio