– Interview mit den Gewerkschaftern Patrick Schreiner und Kai Eicker-Wolf zur aktuellen Debatte –
„Der Sozialstaat begrenzt den Kapitalismus und ermöglicht ihn zugleich. Ihn auf nur eine dieser beiden Funktionen zu reduzieren, würde seiner Bedeutung nicht gerecht.“ Im Interview mit Rosi Haus hauen die beiden Gewerkschafter Patrick Schreiner und Kai Eicker-Wolf kräftig auf die Pauke, halten Sparen im Sozialbereich für den falschen Weg und fordern sogar einen Ausbau des Sozialstaats. Politikwissenschaftler Dr. phil. Patrick Schreiner arbeitet als Gewerkschafter in Berlin und publiziert unter anderem zu wirtschafts- und sozialpolitischen Themen. Ökonom Dr. phil. Kai Eicker-Wolf arbeitet beim DGB Hessen-Thüringen in der Abteilung Wirtschafts- und Strukturpolitik und publiziert unter anderem zu wirtschafts-, finanz- und bildungspolitischen Themen.
Rosi Haus: Sozialstaatliche Leistungen stehen aktuell massiv unter Druck. Bundeskanzler Freidrich Merz tat im Sommer kund, dass wir uns „dieses System“ nicht mehr leisten könnten. Tiefgreifende Reformen und Einschnitte seien angezeigt. Stimmt das?

Eicker-Wolf: Nein, ganz gewiss nicht. Sozialministerin Bärbel Bas hatte schon recht, als sie Merz‘ Äußerungen als „Bullshit“ bezeichnet hat – wenngleich sie jetzt auf den gleichen Zug aufspringt. Es ist nichts Neues, dass der Sozialstaat gerade dann angegriffen wird, wenn es konjunkturell nicht läuft. Ganz im Gegenteil: Das sind im Grunde die erwartbaren Reflexe von Unternehmensverbänden und von ihnen nahestehenden Politikerinnen und Politikern.
Könnt Ihr das genauer erläutern?
Schreiner: Schwächelt die Konjunktur, dann fließen auch die Steuern nicht wie gewohnt. Zudem werden mehr staatliche Leistungen abgerufen, weil mehr Menschen arbeitslos werden. Darauf reagiert die Kapitalseite mit der These, der Sozialstaat sei nicht mehr finanzierbar. Die konjunkturelle Lage blenden sie aus. Die steigende Arbeitslosigkeit stärkt zudem die Kapitalseite, weil die Beschäftigten erpressbarer werden. Es eröffnen sich neue politische Möglichkeiten für das Kapital.
Der Begriff „Struktur“ soll dabei suggerieren, man gehe mit seinen Maßnahmen tiefer als nur bis zur Oberfläche, ja man müsse dies sogar tun. Faktisch meint „Struktur“ aber stets den Sozialstaat selbst. Der Sozialstaat wird zum Hindernis für den wirtschaftlichen Aufschwung erklärt, zum Hindernis für eine bessere Zukunft.
Das heißt, Ihr geht davon aus, dass der Sozialstaat dauerhaft umkämpft ist?
Patrick Schreiner: Ja, das erleben wir in unserer gewerkschaftlichen Praxis ja auch laufend. Gesellschaftliche Auseinandersetzungen etwa um Fragen der Regulierung der Arbeitszeit, der Ausgestaltung des Bildungssystems und der Alterssicherung spiegeln die gegensätzlichen Interessen der abhängig Beschäftigten auf der einen und der Vermögenden und Produktionsmittelbesitzenden auf der anderen Seite wider.

Die Kapitalseite sieht sozialstaatliche Leistungen und Maßnahmen als Belastung für ihre Profite. Zu Recht, ist damit durchaus oft die direkte oder indirekte Umverteilung von Profiten verbunden, beispielsweise durch den Anteil der Arbeitgeber an den Sozialbeiträgen oder durch das Zahlen von Steuern. Die abhängig Beschäftigten hingegen sind auf sozialstaatliche Leistungen und Maßnahmen angewiesen, man denke an die Kranken- und Arbeitslosenversicherung oder an Arbeitsschutzregelungen. Insofern setzt der Sozialstaat der Kapitalverwertung Grenzen.
Eicker-Wolf: Aber auch wenn es erstmal paradox klingt: Der Sozialstaat ist in vielerlei Hinsicht auch eine zentrale Voraussetzung des Kapitalismus. Man denke zum Beispiel an den Bildungsbereich. Ohne eine breite Bildung der Bevölkerung würde der zeitgenössische Kapitalismus nicht funktionieren. Auch der Arbeitsschutz oder Gesundheitsleistungen sind letztlich im Interesse der Kapitalseite. Sicher nicht für jedes Unternehmens zu jeder Zeit, aber doch im Grundsatz – und sei es nur, um den sozialen Frieden und die gesellschaftliche Ordnung aufrechtzuerhalten.
Schreiner: Zusammengenommen begrenzt der heutige Sozialstaat den Kapitalismus und ermöglicht ihn auch. Ihn auf nur eine dieser beiden Funktionen zu reduzieren, würde seiner Bedeutung nicht gerecht.
Gegenwärtig wird in der Debatte um den Sozialstaat vor allem das Bürgergeld infrage gestellt. Dieses werde missbraucht, es ist von Sozialschmarotzern die Rede. CDU-Generalsekretär Linnemann hat ja schon verkündet, „Komplettverweigerern“ das Bürgergeld komplett streichen zu wollen. Und auch Sozialministerin Bas plädiert zumindest für härtere Sanktionen, wenn Bürgergeld-Empfänger:innen ohne Grund nicht zu Terminen im Jobcenter erscheinen. Wie ist das einzuordnen?
Schreiner: Das ist Hetze gegen Arme, wie sie im Kapitalismus leider immer schon stattfand. Gemessen am Sozialstaat als Ganzem ist der finanzielle Aufwand für das Bürgergeld ein vernachlässigbares Detail. Aber wer den Sozialstaat angreifen will, kann hier gut ansetzen, weil moralisierende Hetze gegen Erwerbslose bei vielen Menschen verfängt. Fakt ist aber: Die große Mehrheit der Erwerbslosen ist um Arbeit bemüht. Und viele arbeitslose Menschen können aus verständlichen Gründen keine Erwerbsarbeit aufnehmen, zum Beispiel weil sie krank. Es ist geradezu lächerlich, so zu tun, als würde eine große Zahl von Bürgergeldbeziehenden das Sozialsystem ausnutzen. Es ist ein Problem im homöopathischen Bereich. Gerade Bas als Arbeitsministerin müsste es besser wissen.
Kannst Du konkrete Zahlen nennen?
Eicker-Wolf: Die Zahl der Bürgergeld-Beziehenden, die ein Arbeitsangebot oder einen Ausbildungsplatz ablehnen, ist sehr gering. Aus diesen Gründen haben Jobcenter im Jahr 2024 gerade einmal knapp 23.400 Sanktionen verhängt. Bezogen auf die Zahl der dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehenden Erwerbslosen sind das gut ein Prozent. Also lächerlich wenig.
Schreiner: Was auch gerne unter den Tisch fällt: Gerade die Hetze gegen Erwerbslose stigmatisiert diese. Wer keine Arbeit hat, bekommt ja in Medien und Internet täglich vorgeführt, was diese Gesellschaft – und Friedrich Merz, Carsten Linnemann, Bärbel Bas – von ihm oder ihr halten. Das führt zu psychischen Problemen – und senkt damit die Chancen der Betroffenen, auf den Arbeitsmarkt zurückzukehren.
Wie sieht es denn jenseits des Konjunkturgeschehens mit der Finanzierung des Sozialstaates aus?
Eicker-Wolf: Dazu muss man sich die Einnahmepolitik der öffentlichen Hand in den vergangenen Jahren anschauen. Die Steuerpolitik ist schon seit rund drei bis vier Jahrzehnten neoliberal ausgerichtet. Das heißt, entlastet wurden insbesondere Kapitaleinkommen sowie generell hohe Einkommen und große Vermögen. Die Jahre von 1997 bis 2009 waren extrem. 1997 wurde von der damaligen CDU/FDP Regierung die Vermögensteuer ausgesetzt – sie ist das bis heute. Dann folgten massive Einkommens- und Unternehmenssteuersenkungen unter Gerhard Schröder. Die Unternehmenssteuer wurde aber auch unter Angela Merkel mit der sogenannten „Unternehmenssteuerreform 2008“ nochmal kräftig gesenkt. Und 2009 erfolgte eine Reform der Erbschaftsteuer, die Unternehmenserbschaften stark begünstigen.
Schreiner: Eine wichtige Rolle spielt außerdem die Schuldenbremse, die ebenfalls im Jahr 2009 ins Grundgesetz geschrieben wurde. Sie hat den Spielraum für sozialstaatliche Maßnahmen eingeschränkt. Auch wenn die Schuldenbremse jetzt etwas gelockert worden ist – eine unnötige Beschränkung von sinnvollen öffentlichen Investitionen bleibt sie nach wie vor.
Eicker-Wolf: Die angesprochenen steuerpolitischen Maßnahmen und die Schuldenbremse sind der wirkliche Grund für die Arbeitgeber-Propaganda, dass der Sozialstaat nicht finanzierbar sei. Das Gegenteil ist richtig. Der Sozialstaat müsste ausgebaut werden. Es fehlen zum Beispiel Erzieher:innen, Pflegekräfte, Lehrkräfte und Sozialarbeiter:innen. Und die Infrastruktur im Bereich des Sozialstaates ist auch vielfach in einem miserablen Zustand, man denke etwa an den Investitionsstau in Kitas und Schulen.
Was würdet Ihr denn vorschlagen, um den Sozialstaat auszubauen?
Schreiner: Sinnvoll wäre natürlich eine Steuerpolitik, die wieder nach Leistungsfähigkeit besteuert. Ein höherer Einkommensteuerspitzensatz und höhere Steuern auf Unternehmensgewinne wären wünschenswert, zudem eine höhere Besteuerung von Vermögen. So sollten Unternehmenserbschaften genauso besteuert werden wie alle anderen Erbschaften auch. Und es wäre sinnvoll, die Vermögensteuer wieder zu erheben.
Ist das denn überhaupt sinnvoll? Droht dann nicht Kapitalflucht, und werden im Falle einer höheren Besteuerung von Unternehmenserbschaften nicht Arbeitsplätze gefährdet?
Eicker-Wolf: Nein, das mit der Kapitalflucht ist ein Märchen. In Deutschland haben wir noch immer viele sehr gut ausgebildete Fachkräfte, eine relativ gute Infrastruktur, ein funktionierendes Rechtssystem usw. Da überlegen sich Unternehmen sehr genau, wo sie investieren oder ihren Standort wählen. Tatsächlich gibt es kaum einen empirischen Beleg dafür, dass die Erhebung von Erbschafts- und Vermögensteuern massive Wohnsitz- oder Vermögensverlagerungen zur Folge hätte.
Mitte Oktober erscheint das von Eicker-Wolf und Schreiner verfasste Buch „Sozialstaat“ in der Reihe Basiswissen Politik/Geschichte/Ökonomie des PapyRossa Verlags. Das Buch umfasst 130 Seiten und wird zwölf Euro kosten.
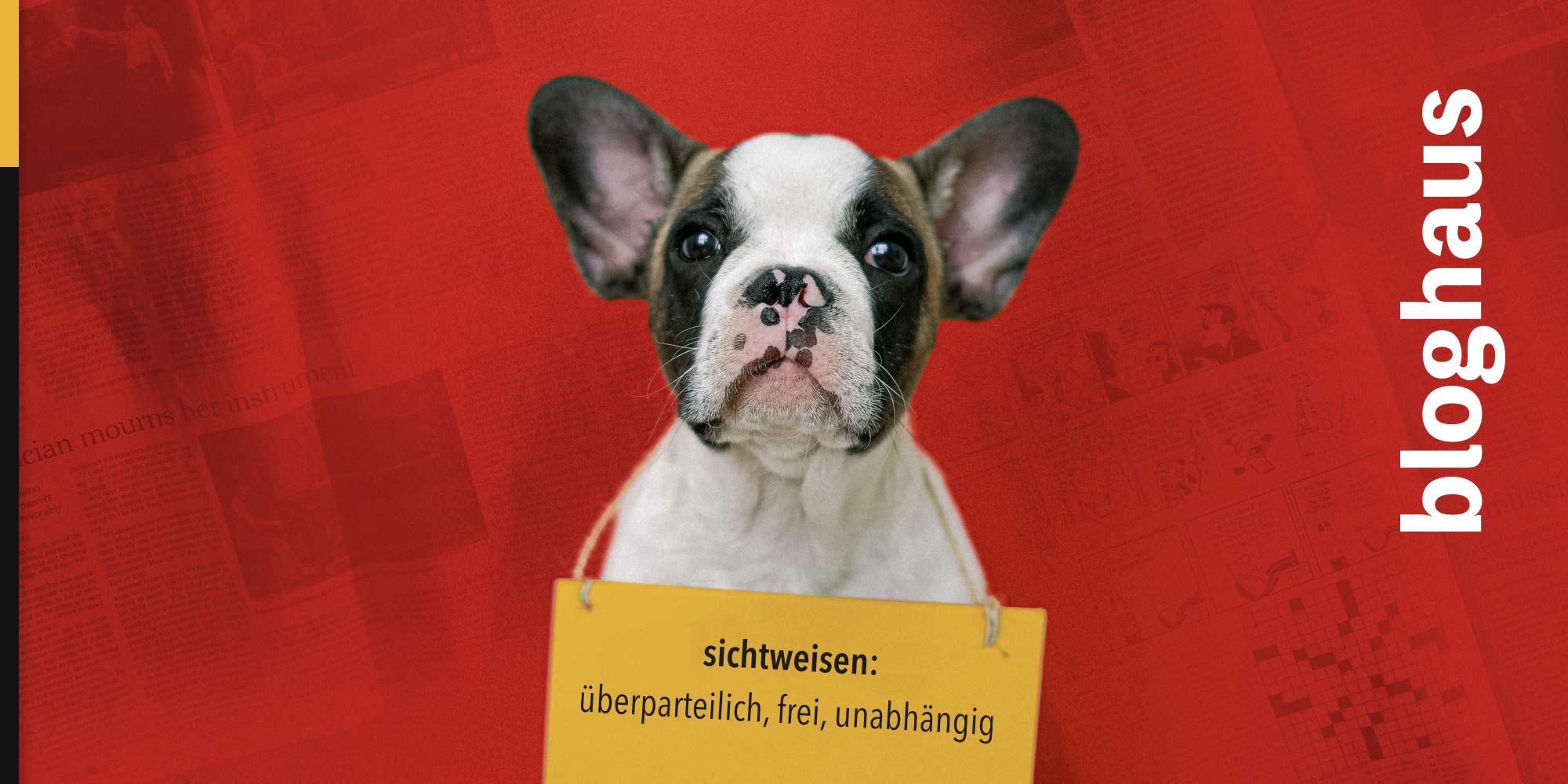
Sorry, aber der Bullshit wird hier von den Kommentatoren verzapft!