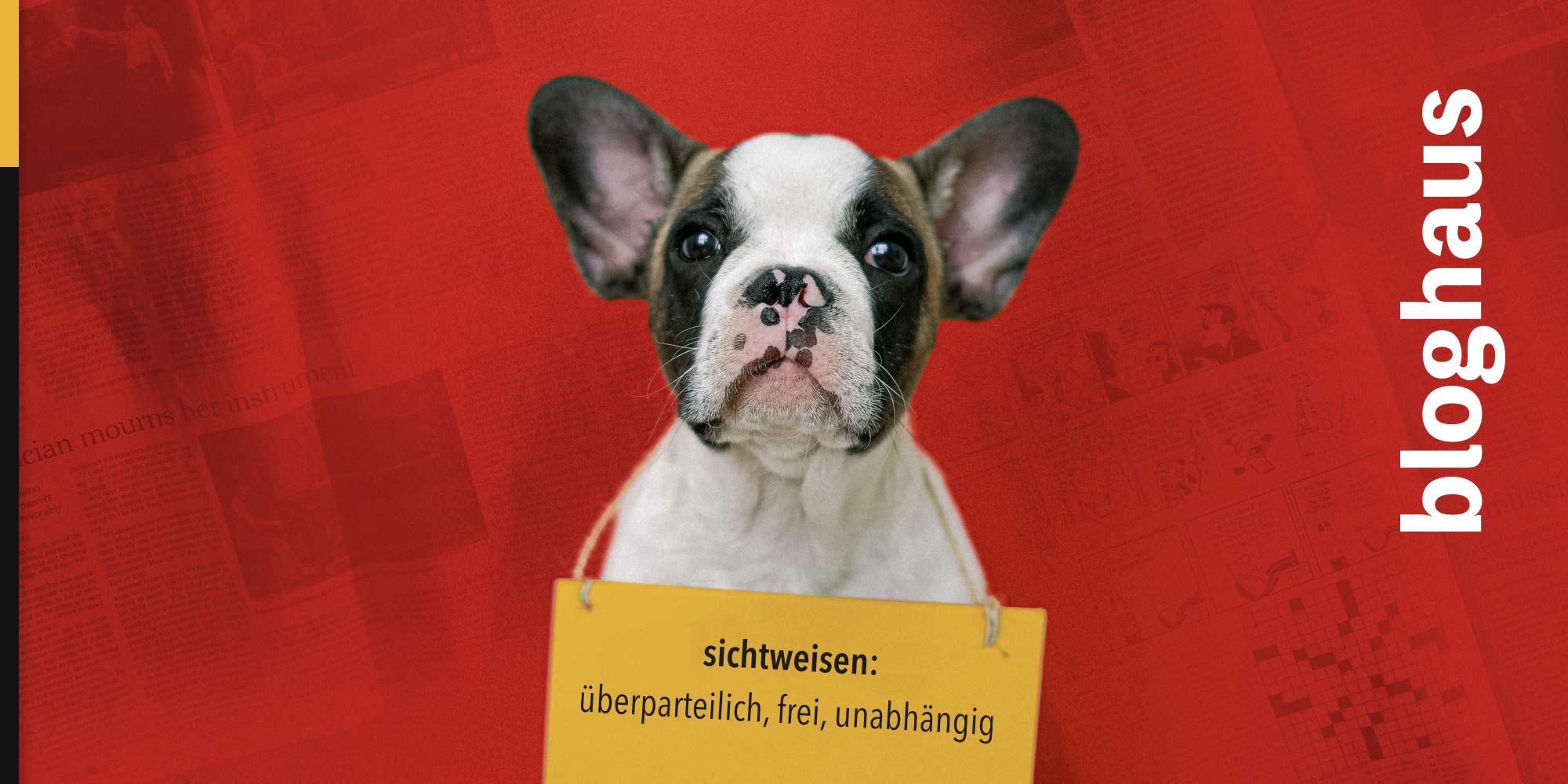– Politischen Steuerverschwendern drohen in der Regel keine Konsequenzen –
Fehlentscheidungen oder ausbleibende Sorgfalt kosten viele Steuer-Millionen, zuletzt sogar Milliarden. Früher traten die dafür verantwortlichen Politiker zurück, nahmen so öffentlichen Vorwürfen die Wucht und ihre jeweilige Partei aus der Schusslinie. Heute mutiert die Verschleuderung von Steuern geradezu zur lässlichen Sünde. Die Gleichgültigkeit in der Politik und die massive Weigerung, Fehler wirklich aufzuarbeiten, ist nahe null. Gibt es einen Ausweg? Lassen sich Politiker haftbar machen? Wer bestimmt das Strafmaß?
Weder die Versäumnisse forsch abstreitenden Protagonisten noch ihre Parteien haben so recht Lust an einer Aufklärung skandalumwitterter Umstände. Und – das kann man sich nicht ausdenken: So manche(r) wird aus der Schusslinie genommen und sogar befördert. CSU-Politiker Alexander Dobrindt zum Beispiel. Er hat die Ausländermaut auf den Weg gebracht, sein Nachfolger und Parteifreund Andreas Scheuer voreilig entsprechende Verträge geschlossen. Beide handelten entgegen allen Warnungen, diese Maut-Variante sei nicht mit dem EU-Recht vereinbar. Am Ende musste der Bund 243 Millionen Euro Schadenersatz zahlen. Außerdem haben die beiden Parteifreunde kräftig daran mitgewirkt, die Verkehrsinfrastruktur sich selbst zu überlassen. Und jetzt ist Dobrindt Innenminister.
Aber man muss nicht nur Unsummen in den Sand setzen, auch Verstöße gegen Compliance-Regeln stehen der Karriere nicht entgegen. CDU-Politikerin Julia Klöckner hat als Bundeslandwirtschaftsministerin in einem Video die geforderte Distanz zu Nestlé vermissen lassen und damit mit ihrem Gesicht quasi Werbung für den Lebensmittelkonzern gemacht. Das geht gar nicht. Jetzt ist sie Bundestagspräsidentin. Oder CDUler Philipp Amthor, der als Bundestagsabgeordneter für die Interessen eines Unternehmens lobbyierte, von dem er später Aktienoptionen und einen Direktorenposten erhielt. Während der Koalitionsverhandlungen soll er versucht haben, eben gerade jenes Informationsfreiheitsgesetz abzuschaffen, durch das seine Verwicklungen aufgedeckt worden waren und das noch von der Ampelregierung modernisiert werden sollte. Amthor ist nun Staatssekretär, zuständig für Staatsmodernisierung und Bürokratieabbau, dem ja die Abschaffung der ohnehin schon eingeschränkten Transparenz durchaus noch zum Opfer fallen könnte. Willkommen in einer Welt, die Satirikern den Stoff frei Haus liefert.
Zurück zu Verschwendung und Veruntreuung. Wo bleibt die Empörung, vor allem angesichts der veruntreuten Summen, die ein Hundertfaches dessen betragen, für das sogenannte Sozialschmarotzer in Verantwortung genommen werden? Es scheint fast so, dass mit steigender Höhe des Schadens ähnlich dem Umgang mit Steuerbetrug das Interesse des Staates an Aufklärung und Bestrafung nachlässt. Die unbefriedigende Aufarbeitung des Cum-Ex-Skandals und die ungeklärte Rolle von Olaf Scholz (SPD) in diesem Schmierenstück der so seriös auftretenden Mitglieder der Steuervermeidungsmafia kann da als Paradebeispiel herhalten. Man lässt die Hunde kläffen, Michel spielt unterdessen „Esel streck dich!“ bis der Unschuld dank Anwälten und Lobbyisten Flügel wachsen und der Schwarm meist ungerupft weiterzieht. Ins Bild passt, dass der Bundesrechnungshof jährlich auf enorme Verschwendungen hinweist, die immer wieder nach ähnlichem Muster ablaufen, weil die Behörden keine Rückschlüsse daraus ziehen oder gar jemand persönlich dafür in Regress genommen wird: Same procedere as last year, no effect as every year.
Verschlusssache Spahn

Zu den prominenten Verschwendern zählt aus aktuellem Anlass CDU-Fraktionschef Jens Spahn, dessen Maskenaffäre aus Gesundheitsministerzeiten ihn dieser Tage in Bedrängnis bringt. Ein 170-seitiges Gutachten der im Sommer 2024 vom damaligen Gesundheitsminister beauftragten Sonderermittlerin Margaretha Sudhof (SPD) mit hunderten geschwärzten Stellen legt Mängel während der Pandemie offen. Das Ergebnis stieß bei Spahns CDU-Parteifreundin und Neu-Gesundheitsministerin Nina Warken allerdings offenbar auf wenig Begeisterung. Die als „Verschlusssache“ klassifizierte interne Aufarbeitung der Maskenbeschaffung wollte Warken nicht veröffentlichen. Stattdessen sollte der Sudhof-Bericht nur in einen eigenen, neuen Bericht des Ministeriums „einfließen“. Daran hielt Warken lange fest, obwohl der Druck wuchs. Teile des Berichts wurden öffentlich, weil Medien wie die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ) recherchierten. Schließlich knickte Warken ein und schickte das Dokument mit besagten Teilschwärzungen per Mail an die Mitglieder des Haushaltsausschusses im Bundestag.
Es geht um Millionenverluste für den deutschen Staat, ungewöhnliche Vergaben und politische Einflussnahme. Denn weiterhin ist der Verdacht nicht ausgeräumt, dass im Spahn-Ministerium in einer Ausnahmesituation nicht nur milliardenschwere Fehler gemacht wurden, sondern auch parteipolitische Interessen zu der Maskenmisere beigetragen haben könnten. Bei den großflächigen Schwärzungen soll es sich nach Angaben WDR, NDR und „Süddeutsche Zeitung“ zum Beispiel um die Maskenkäufe bei der Schweizer Firma Emix handeln, die die Tochter des ehemaligen CSU-Generalsekretärs Gerold Tandler an Jens Spahn vermittelte und dafür mehrere Millionen Euro Provision kassierte. Was in ihnen genau steht, ist nicht bekannt.

Spahn soll entgegen den Warnungen aus dem zuständigen Innenministerium das in seiner Heimat firmierende Münsterländer Mittelstands-Logistikunternehmen Fiege anstelle der erfahrenen Branchenriesen DHL und Schenker beauftragt haben. Fiege war letztlich wie befürchtet überfordert, Maskenlieferanten blieben auf ihrem Bestand sitzen. Der Bund klagt aus unerfindlichen Gründen nicht auf Schadenersatz. Dafür lassen die Firmen nicht locker. Zwischen 2,3 und 3,5 Milliarden Euro soll die Gesamtsumme liegen, weil das Gesundheitsministerium ihnen die Abnahme zu einem festen Preis zugesagt hat.
Ebenso fällt Spahn auf die Füße, dass er statt der Empfehlung aus dem eigenen Haus, für eine FFP2-Maske weniger als drei Euro zu zahlen, per äußerst flapsig formulierter Mail – „Jetzt will ich rechtlich verbindlich das Zeug;-)“ – eine unbegrenzte Abnahme dieser Schutzmasken für 4,50 Euro pro Stück garantierte. Auf Basis dieser Mail klagt jetzt ein Hersteller auf Zahlung. Die Zwinker-Smiley-Nachricht könnte die öffentliche Hand noch mehrere Millionen kosten.
Im Sudhof-Bericht heißt es, „fehlendes ökonomisches Verständnis“ und „politischer Ehrgeiz“ hätten am Ende dazu geführt, dass in der Pandemie als „Team Ich“ und nicht als „Team Staat“ gehandelt worden sei. So habe Spahn im März 2020 beschlossen, „die Beschaffung allein meistern zu wollen“. Daraufhin stieg das damals von ihm geführte Bundesgesundheitsministerium (BMG) in die Maskenbeschaffung ein. Am Ende ließ Spahn Corona-Masken im Wert von knapp sechs Milliarden Euro kaufen. Etwa zwei Drittel davon wurden nie gebraucht und wegen hoher Lagerkosten vernichtet.
Auch von anderer Seite ist Jens Spahn unter Druck geraten. So setzt sich der Bundesrechnungshof in einem wieder einmal nicht öffentlichen Prüfbericht (warum?) mit dem sogenannten Corona-Versorgungsaufschlag auseinander, durch den Spahns Gesundheitsministerium während der Pandemie Krankenhäuser mit zusätzlichen Milliarden Euro versorgte. Eine Analyse der Maßnahme zeigt: Laut Rechnungshof verschwendete Spahn dabei insgesamt 3,1 Milliarden Euro. Die Maßnahme habe „sich auf keine validen Belastungsdaten“ gestützt, hatten „keine nachhaltige Wirkung“ und „war unwirtschaftlich“, schreibt der Rechnungshof. Sie sei „planlos und abgekoppelt von den tatsächlichen Bedarfen“ erfolgt. Die ungewöhnlich deutliche Kritik des Bundesrechnungshofs zeigt enorme Versäumnisse von Spahn. Durch die Milliardenspritzen an die Krankenhäuser sei ein dysfunktionales System am Laufen gehalten und notwendige Reformen verzögert worden, heißt es.
Finanzaffäre Habeck
Der Bundesrechnungshof hat auch Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) im Visier, der das 600-Millionen-Debakel, um den inzwischen insolventen Batteriehersteller Northvolt zu verantworten hat. Laut „Bild“ werfen die Rechnungsprüfer Habeck in einem geheimen (warum?) Gutachten vor, 2023 viel zu leichtfertig Steuergeld an Northvolt vergeben zu haben. Konkret geht es um einen Staatskredit von 600 Millionen Euro (Wandelanleihe) an den Batteriehersteller. Northvolt sollte mit dem Kredit (und weiteren deutschen Subventionen) in Heide (Schleswig-Holstein) ein Batteriewerk bauen. Die Firma ist mittlerweile pleite, den deutschen Steuerzahlern droht der Totalverlust. Habeck und seine Beamten hätten „die Risiken für den Bund systematisch“ unterschätzt. Auch ein entsprechendes Gutachten der Prüfgesellschaft PwC (mittlerweile ebenfalls als geheim eingestuft) zu Northvolt habe die Risiken nicht richtig aufgezeigt. Es sei jedoch nicht zu erkennen, dass das Wirtschaftsministerium „zentrale Annahmen des Unternehmenserfolgs hinterfragte“, so die Rechnungsprüfer. Ihr brisantes Fazit: Das Wirtschaftsministerium habe „wesentliche Risiken der Wandelanleihe unzureichend ermittelt und bewertet. Es agierte stattdessen weitestgehend nach dem Prinzip Hoffnung“. Das Northvolt-Debakel sei eine der großen Finanzaffären der Republik“, heißt es.

Die Prüfer werfen Habeck und seinen Beamten außerdem Verstöße gegen „die Pflicht zur ordnungsgemäßen Aktenführung“ vor. So seien wesentliche Entscheidungsschritte zum Staatskredit nicht dokumentiert worden. Die Prüfer: Damit entziehen sich wesentliche Handlungen der „Nachvollziehbarkeit und einer externen Kontrolle“. Das gelte insbesondere für Videokonferenzen mit anderen Gutachtern (PwC). Die Verstöße würden aufgrund der politischen und finanziellen Bedeutung des vorliegenden Falls besonders schwer wiegen, heißt es im Gutachten.
Der CDU-Haushaltspolitiker Andreas Mattfeldt zeigt sich schockiert: „Man gewinnt den Eindruck, dass hier nicht nur grobe Fahrlässigkeit im Spiel ist. Es hat den Anschein, dass es mutmaßlich Vorsatz war.“ Die Akte Northvolt biete für Habeck „Sprengstoff. Wird deshalb versucht, sie geheim zu halten?
Von der Leyen mauert
Geheimnisumwittert segelt auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) durch ihre Affären. Sie steht unter anderem im Mittelpunkt eines Vorfalls, der die europäischen Steuerzahler Milliarden kostet. So wirft das Europäische Parlament der von ihr geführten Behörde vor, Ungarn für einen politischen Deal zu Unrecht Milliarden ausgezahlt zu haben. Ob sie sich als Leiterin der Behörde bald vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) verantworten muss, steht angesichts der in Brüssel und Straßburg vorherrschenden Wagenburgmentalität in den Sternen. Unter anderem gelingt es der Europäischen Staatsanwaltschaft EPPO ja schon nicht, ein 2022 eingeleitetes Ermittlungsverfahren gegen von der Leyen abzuschließen. Dabei geht es um undurchsichtige Milliarden-Geschäfte mit Corona-Impfstoffen via SMS zwischen dem Pharmariesen Pfizer und der EU-Kommissionspräsidentin. Bisher scheiterte die geforderte Aufklärung an einer Mauer des Schweigens innerhalb der EU-Behörden. Zu den bisher nur grob geschätzten 35 Milliarden Euro Schaden müssten noch die Kosten für die Nachfolgeverträge in Höhe von mindestens 5,6 Milliarden Euro bis 2026 gezählt werden, für Impfdosen in Größenordnungen, die keiner benötigt!
Doch damit nicht genug. Streng genommen müssen noch die von der EU für die Erforschung der Impfstoffe zur Verfügung gestellten 1,4 Milliarden Euro addiert werden. Nach einer Studie der Harvard Medical School sind so weltweit insgesamt 32 Milliarden Dollar aus öffentlicher Hand in die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen geflossen. Also hat der Steuerzahler dreimal für seine Immunisierung in die Tasche greifen müssen: Für die Forschung, zur Finanzierung der aufgeblähten Preise und ein letztes Mal für die kreativen Steuervermeidungsmodelle der Pharmariesen.
Der offizielle Grund für die ausufernde Heimlichtuerei in der Causa von der Leyen / Pfizer war der „Schutz der Geschäftsgeheimnisse von Pfizer“ – der offenbar höher eingestuft wurde als das Recht auf Information der Bürgerinnen und Bürger der EU, etwas über den Verbleib der europäischen Milliarden zu erfahren.

Es passt in dieses Bild der groß angelegten Verschleierung, dass von der Leyen vorsorglich zumindest einen Teil des SMS-Austauschs mit dem Pfizer-Chef Albert Bourla gelöscht hat und die Herausgabe des Restes verweigert. Die New York Times klagte daraufhin auf die Herausgabe mit der Begründung, dass der persönliche Mail-Kontakt zwischen von der Leyen und Pfizer-Chef Bourla für den Abschluss des Vertrages über die Lieferung von bis zu 1,8 Milliarden Dosen Corona-Impfstoff im Volumen von etwa 35 Milliarden Euro entscheidend gewesen sei. Jetzt gibt es ein Urteil des Gerichts der Europäischen Union (EuG) zugunsten der Kläger. Die Zeitung und ihre in dem Fall zuständige Journalistin hätten relevante Anhaltspunkte für die Existenz von Nachrichten zwischen von der Leyen und dem Pfizer-Chef Albert Bourla dargelegt. Damit muss die EU-Kommission nun erneut über die Anfrage der Zeitung entscheiden, die auf Offenlegung der Textnachrichten gerichtet ist (Urt. v. 14.05.2025, Rs. T‑36/23).
Die Kommission vertritt aber nach wie vor auf den Standpunkt, es lägen keine relevanten Nachrichten vor, die herausgegeben werden könnten. Das hat sie aber nicht hinreichend begründet, wie nach dem EuG-Urteil feststeht.
Die Verschleierung hat bei Ursula von der Leyen Methode. Schon einmal stand sie wegen ihres Umgangs mit Handydaten in der Kritik. Noch in ihrer Zeit als deutsche Verteidigungsministerin gingen Gesprächsprotokolle mit ihrem Diensthandy „verloren“. Kritiker monierten, dass dadurch Beweise in der in der sogenannten Berateraffäre verloren gegangen seien. Verträge in Höhe von etwa 155 Millionen Euro waren damals an private Beraterfirmen geflossen. Der Verdacht, dass die Aufträge zum Teil illegal vergeben worden waren und Vetternwirtschaft mit im Spiel war, konnte nie ganz entkräftet werden.
Die Frage der Haftung
Allen angeführten Vorfällen gemein ist die versuchte Vertuschung und Verweigerung der Herausgabe von Unterlagen, um die Aufklärung zu erschweren. Warum? Bundesminister tragen zwar politische Verantwortung, eine persönliche Haftung für schuldhaft verursachte Schäden ist aber nicht vorgesehen. „Das Grundgesetz regelt mit dem Amtshaftungsanspruch zwar die Haftung von Schäden, die durch Amtsträger verursacht wurden. Aber dieser bezieht sich nur auf Beamte, nicht auf Politiker“, erklärt Wolfgang Hecker, ehemals Professor für Staats- und Verfassungsrecht an der früheren Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung gegenüber der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Damit Minister haften, bräuchte man also eine Spezialnorm im Bundesministergesetz – und die gibt es aktuell nicht. „Die Regelungslücke im Ministergesetz gehört dringend geschlossen“, sagte der Präsident des Bundes der Steuerzahler Reiner Holznagel anlässlich der Insolvenz des Batterieherstellers Northvolt (siehe oben). Wer mit Steuer-Milliarden Risiken eingehe, müsse auch die Verantwortung dafür übernehmen.
Der Innenaussachuss des Bundetages befasst sich derzeit mit einem Gesetzentwurf der AfD-Fraktion, demzufolge Mitglieder der Regierung für Schäden haften, die sie vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben. Die AfD begründet den Entwurf mit wiederholten „staatlichen Fehlentscheidungen, die konkrete Entscheidungsträgern zugeordnet werden können und den Steuerzahler viele Millionen oder sogar Milliarden kosten“. Als Beispiele nennt die Partei neben Northvolt auch die Beschaffung von Masken zum Beginn der Corona-Pandemie.
Sollen Minister künftig finanziell analog Unternehmern oder Beamten belangt werden können? Das würde das Risiko beinhalten, dass demokratisch legitimierte Entscheidungsträger in ihrer Güterabwägung eingeschränkt wären und ein effektives Regieren durch Stillstand und Risikovermeidung erschwert würde. Für eine neue Haftungsnorm mit einem gedeckelten Betrag, spricht aber, dass sich Minister ja fachliche und juristische Expertisen einholen können, ehe sie entscheiden.
Ministergesetz greift nicht
Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ) hat darauf hingewiesen, dass es auf Landesebene die Haftungsregelung schon gibt. „Das Bayerische Ministergesetz zeigt, wie es besser geht“, meint Holznagel. Danach müssen Minister im Falle einer schuldhaften Amtspflichtverletzung dem Freistaat Bayern die daraus entstandenen Schäden ersetzen. Die Vorschrift entspricht also den Haftungsregeln für Beamte. Aber: Dass die Norm existiert, bedeutet jedoch nicht, dass sie auch tatsächlich angewandt wird. Wie das Bayerische Finanzministerium der FAZ bestätigte, kam der Artikel in den letzten 20 Jahren kein einziges Mal zur Anwendung. Es fehlt also am politischen Willen zur Durchsetzung, weil dann befürchtet wird, dass niemand mehr Verantwortung für weitreichende Entscheidungen übernehmen will. Vielleicht würde es helfen, die Haftung auf einen symbolischen Betrag zu deckeln. Auf alle Fälle aber müssen die Hintergründe aller Affären transparenter werden.
Lesen Sie auch: SMSgate im Augiasstall EU