– Die Sozialdemokratie liegt auf der Intensivstation –
Die Genossen wissen, es muss etwas passieren, sonst war’s das mit der SPD als Volkspartei. Also planen die Sozialdemokraten bis 2027 ein neues Grundsatzprogramm. Doch die Krise ist aktuell und längst existenziell. Das Dilemma: Ein grundlegend neues Zukunftsversprechen für die Gesellschaft braucht Zeit. Zeit, so glauben viele, die Mitarbeit in einer Regierungskoalition nicht gewährt.
Und es zeichnet sich noch nicht einmal in Ansätzen ab, was zur Steigerung der Attraktivität dieser Partei beitragen könnte. Denn die Liste der von der SPD zu kapernden Themen mit Publikumswirkung ist kurz. Es fehlt an Ideen, aber auch an charismatischem Personal, das erfolgversprechende Fundstücke gewinnbringend verkaufen kann. Letztlich müssen Inhalte durch Glaubwürdigkeit von Personen verankert werden. Ganz nebenbei fehlt den beiden Parteivorsitzenden Lars Klingbeil und Bärbel Bas als Mitgliedern der Koalition mit CDU/CSU die Beinfreiheit bei programmatischen Fragen. Zumindest für Klingbeil gilt zudem, dass er sich in der Rolle als Finanzminister wohl kaum wird positiv profilieren können.
Die Aufgabe erschwert ein Regierungspartner, der sich als Gegenspieler der SPD gefällt. Im Zusammenspiel mit der Springer-Presse torpedieren CDU-Fraktionschef Jens Spahn und CSU-Vorsitzender Markus Söder eine gedeihliche Zusammenarbeit in dieser Koalition. Ihr Ziel scheint eine Minderheitsregierung zu sein. „Bild“ als Sprachrohr der Befürworter einer Zusammenarbeit mit der AfD titelt schon offiziell: „Teile der Fraktion wollen eine Alternative zur SPD.“ Die SPD tut sich immer noch schwer zu punkten, wenn ein Jens Spahn pöbelt: „Wir werden nicht mit denen untergehen“, während der von Teilen der Fraktion getriebene CDU-Kanzler Friedrich Merz den eigenen Leuten versprechen muss: „Wir werden mit der SPD jetzt Klartext sprechen.“
Ein weiteres Dilemma der Sozialdemokraten: Wenn es um Grundsätzliches geht, ist interner Streit absehbar. Vor kaum sechs Monaten hat die SPD die Großen Koalition unterschrieben. Manche sagen, in diesem Papier habe die Arbeiterpartei mehr strittige Punkte durchgesetzt als ihr mit gerade mal 17 Prozent bei der letzten Wahl zugestanden hätten. Geschenkt. Die Arithmetik gestattet nur ein Zusammengehen mit der CDU. Man muss das Abkommen nicht ambitioniert nennen, aber zumindest viele Vereinbarungen, auch die zum Bürgergeld, sind eindeutig. Streit, so lehrt die Erfahrung, wird von der Öffentlichkeit nicht honoriert, zumal wenn eine Regierungspartei im Koalitionsvertrag das Gegenteil vereinbart hat.
Der bröckelnde Konsens über die Bürgergeld-Reform ist aktuelles Beispiel für die tiefe Identitätskrise einer Partei, der die Mitglieder davonlaufen und der in Umfragen das Wasser bis zum Hals steht – Tendenz Unterkante Oberlippe. Aber in Berlin, im Willy-Brandt-Haus, tanzt der Kongress. Natürlich lässt sich über die Höhe des Bürgergeldes, die Pflicht zur Kooperation, über Sanktionen oder Fordern und Fördernsich trefflich streiten. Aber ein Hüh und Hott im Monats-Rhythmus wird der Wähler an der Urne nicht honorieren.
Die ganz Alten erinnern sich an die erste Große Koalition. Dezember 1966. Die CDU und ihr Kanzler Ludwig Erhard hatten die Regierung gerade in den Sand gesetzt. Die Republik schwankte zwischen Flaute und Revolte. Willy Brandt, Herbert Wehner und Helmut Schmidt, die Granden der SPD aus der Baracke, so proletarisch nannte sich das Hauptquartier der SPD einst, mögen sich wechselseitig für Apparatschiks, Kleinbürger oder Träumer gehalten haben. Aber alle drei wussten, nur wenn sie Kurs halten, Kompetenz zeigen und die Fähigkeit beweisen Entscheidungen zu treffen, haben sie bei der nächsten Wahl eine Chance. Und die Lebenswirklichkeit für sie war nicht einfach: Im Kabinett ein Kanzler, der ähnlich wie heute Friedrich Merz irrlichterte, ein Franz Josef Strauß, der wenige Jahre zuvor in der Spiegel-Affäre demokratische Regeln mit Füßen trat, ein Schatzminister, der Mitglied der NSDAP war. Und draußen: Steigende Arbeitslosigkeit und auf der Straße selbstbewusste, meist junge Menschen, die gegen den Vietnamkrieg, gegen Notstandsgesetze und für mehr Bildung demonstrierten.
Die SPD begriff damals eine GroKo ohne ständige Hofkabalen als Chance. Die Grundlagen für die Ostpolitik, für die Normalisierung des Alltags Richtung DDR, für die Entkriminalisierung der Paragrafen 218 und 175, für die Städtebauförderung und für mehr Mitbestimmung wurden in den knapp drei Jahren dazwischen gelegt. Legendär wie das ungleiche Paar Franz Josef Strauß und Karl Schiller als Plisch und Plum gemeinsam an einem Strang Rezession und Arbeitslosigkeit bewältigten. Der Wähler dankte es der SPD beim Urnengang 1969. Der Genosse „Trend“, heute ein Eremit, eroberte das Land.
Auch jetzt leistet die SPD in diversen Koalitionen im Maschinenraum der Regierungsverantwortung Kärrnerarbeit. Aber ihre Erfolge gehen in ständigem Selbstmitleid und in der fortwährenden Litanei eines „Mea Culpa“ unter, so groß die Erfolge auch sein mögen. Bei Rente, Mindestlohn, Investitionsprogramm, Aufhebung der Schuldenbremse oder Bürgergeld konnten Sozialdemokraten mit einem Sechstel der Stimmen einen Batzen an eigener Programmatik durchsetzen und konservative Luftnummern verhindern.
Aber es ist wie immer. Schnell naht die Stunde der Leichtmatrosen, denen beim Rudern langweilig wird, und die mit Vorliebe über jedes Stöckchen wie jüngst beim vom Bundeskanzler gezeichneten Stadtbild springen. Ob Nachkarten beim Mindestlohn, Aufschnüren beim Kompromiss zur Wehrpflicht oder Mitgliederbefragung beim Bürgergeld, jedes Grummeln an der Parteibasis bringt die mittlerweile doppelte Parteispitze aus dem Tritt. Klar: Man kann jeden Wunsch nach Veränderung damit entschuldigen, dass der Partner, die CDU programmatisch entkernt, auch ihre Flügel kaum noch kitten kann. Aber beeindruckt dieser Vergleich die Wähler?
Der römische Feldherrn Gaius Julius Caesar soll bei der Fahrt durch ein Alpendorf gemurmelt haben, „Lieber hier erster als in Rom zweiter“. Im Poesiealbum der SPD steht das Bonmot für die Sehnsucht: lieber die Mehrheit im Parteivorstand als gemeinsam mit der Konkurrenz an der Zukunft unseres Landes zu arbeiten. Zumal alternative Optionen fehlen: Bündnis 90 / Die Grünen mäandern nach dem Abgang von Annalena Baerbock und Robert Habeck immer noch zwischen Trauer und Erleichterung. Bei den Linken fehlt der Beweis, dass sich ihre gelungenen Bilder auf Tik Tok im wahren Leben bewähren und Sahra Wagenknechts BSW verliert mit jedem „Nein“ von Putin zu einem Waffenstillstand an Prozenten.
In den USA haben die traditionellen Republikaner der radikalen Tea Party die Hand gereicht. Heute, nur wenige Jahren später, sind sie entsorgt. Wir erleben, wie ein Land auf dem Weg in die Autokratie kollabiert. Viele, die sich abgehängt fühlten, die sich jeden Tag durchs Leben kämpfen mussten, waren es leid, dass der Kongress über Krankenversicherung, Rente, Bildung und Wohnen Jahrzehnte debattierte, ohne dass eine nachhaltige Lösung in Sicht ist. Ihr letzter Ausweg ist der mit der Abrissbirne.
Auch hierzulande droht die Zerstörung der demokratischen Grundlagen: Vom Öffentlich-rechtlichen Rundfunk über die Justiz bis zum Asylrecht. Es sei denn: Berlin hört auf, ständig darüber zu debattieren, ob Coke oder Coke light auf dem Bestellschein steht, und beginnt stattdessen ihren Auftrag Punkt für Punkt abzuarbeiten.
Die Situation ist ernst. Europa rückt nach rechts. Auch Deutschland ist vor diesem Ruck nicht gefeit. Mach einer scheint von der Hoffnung beseelt: Wenn die Brandmauer fällt und Fackeln marschieren, dann mobilisieren wir die Massen, haken uns hinter dem Brandenburger Tor unter und halten Autokratie und Faschismus auf. Die Massen werden allenfalls von den Kaffeehausterrassen „Unter den Linden“ zusehen. Bei Latte Macchiato und Aperol Spritz.
Horrorprognosen von 40 Prozent für die AfD werden sich nicht erfüllen, wenn die SPD handlungsfähig ist, egal wie unsortiert die CDU scheint. Und statt bei einer Mitgliedsbefragung ein genehmes Ergebnis zu suchen, sollte der Parteivorstand auf eine Lektion Alltags-Empirie einfach mal in die Vororte von Duisburg oder Gelsenkirchen fahren oder in die Zentren von Eisenhüttenstadt oder Bautzen. Dann findet die Partei auch ihren Markenkern wieder, der in den vergangenen Jahren wegen der strategischen Ausrichtung zur „neuen Mitte“ und einer damit verbundenen Entfremdung von der klassischen Arbeitnehmerschaft und den Gewerkschaften erodiert ist.
Ein programmatisches Ziel könnte ein „Starker Staat“ sein. Keine Nanny-Gesellschaft, keine überregulierte Bürokratie, aber ein Land, das nicht mehr neoliberale Interessen in den Mittelpunkt politischen Handelns stellt; ein Land das die Menschen als gerecht empfinden, weil die Schere zwischen obszönen Reichtum und dem Leben am Existenzminimum trotz harter Arbeit, nicht weiter auseinanderklafft; ein Land, das Arbeit angemessen honoriert; ein Land, das in der Lage ist, seine Regeln durchzusetzen; ein Land, das an der Schwelle zum digitalen Zeitalter seine Menschen nicht den Interessen von internationalen Techno-Konzernen opfert, sondern einen Weg zeigt wie die Veränderungen den Menschen dienen.
Ihre Grundwerte wie Solidarität muss die SPD nicht neu erfinden. Notwendig ist, diese Essentials in unsere Zeit zu übersetzen. Ohne hunderte Spiegelstriche und Nebensächlichkeiten, ohne all die Profilierungsversuche im und für den Mittelbau der Partei, ohne die ständigen Richtungsänderungen. Das wäre ein Politikwechsel, der für Aufbruchstimmung in der Partei und bei den Wählern sorgen kann. Ein solcher Politikwechsel ist grundsätzlich trotz der Regierungsarbeit mit der Union möglich. Ohne Spagat, mit klar definierten Aufgaben von Partei und Kabinett. Die Partei braucht ebenso wie das Land eine breite Debatte über die Herausforderungen der Zukunft, eine Debatte, die externe Strömungen aufnimmt. All diese Herausforderungen in eine neue Politik umzusetzen ist eine Herkulesaufgabe, für die – Beispiel Klimaschutz- die Zeit knapp ist.
Aber bei aller Ungeduld: Die vom Wähler erzwungene Koalition mit der Unioin bietet für die aktuelle Legislaturperiode bis 2029 wenig Handlungsoptionen für den notwendigen Umbau unserer Gesellschaft. Zu groß ist auch die Sinnkrise der Union, zu schwach der Kanzler. Eine CDU ohne Köpfe. Neuwahlen oder eine Minderheitsregierung werden bei diesen Rahmenbedingungen Chaos-Festspiele. Der SPD bleibt in dieser Situation – wie im Dezember 1966 – nur die Option, auch mit kleinen Brötchen, aber klarer Haltung Regierungskunst und -fähigkeit zu beweisen. Es wäre ein Kurs, der zeigt, dass die SPD das Land durch unruhige See zu steuern vermag. Aber dieser Weg wird nur dann von Erfolg gekrönt sein, wenn es der Partei gelingt ein Programm zu verabschieden, das Antworten auf die großen Herausforderungen von morgen gibt: Klima, Digitalisierung, Migration, Sicherheit und Frieden sowie Soziale Gerechtigkeit und Bildung.
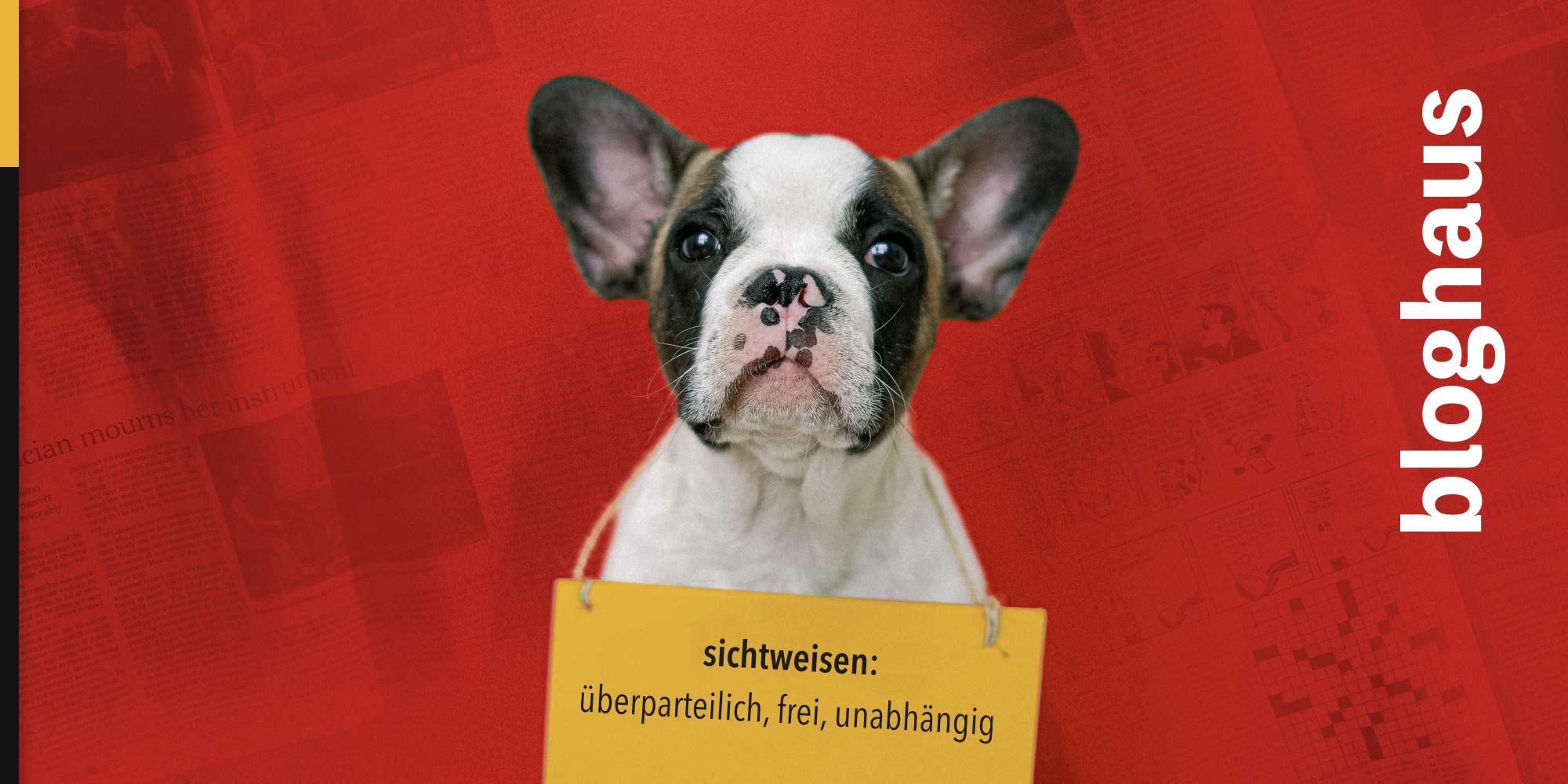


Lieber Mathias, danke für Deinen Bericht, er erinnert mich an „frühere Zeiten“. Es stellt sich die Frage, wie können wir es umsetzen. Wie gibt es noch Gruppierungen, die das „Grundsätzliche“ erarbeiten können?
Gibt es überhaupt noch Chancen, sich zusammen zu setzen, um Vorstellungen in die Diskussion zu bringen? Aus dem Bloghaus kommen aus meiner Sicht gute Vorträge/Berichte/Artikel, die auf breiterer Front ausdiskutiert werden können um sie zumindest in die breitere Parteiöffentlichkeit zu bringen, damit die Gruppe der Meinungsbilder vergrößert werden kann.
Ich hoffe, es geht Dir gut und wir kommen gelegentlich zu einer Diskussion zusammen.
Alles Gute!
Dein Manfred Wirsing
Eine gute Darstellung der desolaten Situation der SPD und man könnte noch einiges hinzufügen.
Wo und wofür steht die SPD? Eine Klientelpartei für Rentner und Sozialempfänger ist keine Volkspartei. Der Kompass in Form eines neuen Programmes fehlt völlig. Dabei lohnt sich ein Blick nach Skandinavien. Bildungsgerechtigkeit, Altersvorsorge, eine moderne ökonomische Ausrichtung aber auch MIgrationthemen zeigen programmatische Richtungen auf, wie man Wahlen gewinnen kann.
Selbst in der Kommunion lässt sich die SPD ins Abseits drängen, da, wie leider häufig, jede Äußerung von den eigenen Parteimitgliedern zerrissen wird.
Wie schafft es die SPD noch aus dieser Downwärtsspirale heraus zu kommen?
Eugen Eckert: Ich teile viele Aspekte des Artikels. Aber kann mir jemnd erklären, warum Robin Mesarosch nicht besser ausgebaut wird? Die Reden, die ich von ihm gehört haben, waren fundiert, engagiert und voller Charisma – gerade auch in Abgrenzung von der AFD.
Mit Grüßen
Eugen Eckert