– Der steigenden Staatsverschuldung werden keine ökonomisch produktiven staatlichen Infrastrukturgüter gegenüberstehen –
Von Kai-Eicker-Wolf
Die Rüstungsausgaben in Deutschland sollen in den kommenden Jahren massiv steigen. Finanziert wird dies vor allem durch Kredite. Während die Beschäftigungseffekte kaum ins Gewicht fallen, wird der so verursachte Anstieg der Verschuldung zu einer ökonomischen Belastung.
Die offizielle Zielgröße für die Aufrüstung setzte Ende Juni das Nato-Gipfeltreffen in Den Haag. Die Mitgliedstaaten sollen ihre Militärausgaben auf 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) steigern. Hinzu kommen 1,5 Prozent für den Schutz kritischer Infrastruktur, den Ausbau militärisch nutzbarer Straßen und Brücken usw.
In Deutschland ermöglicht die bereits vor diesem Beschluss im März erfolgte Änderung an der Schuldenbremse im Grundgesetz die Finanzierung diese gigantische Aufrüstung. Danach kann der Bund Verteidigungsausgaben über einem Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP)durch neue Schulden finanzieren. Rüstungsausgaben fallen so ab dieser Höhe nicht mehr unter das generelle Kreditaufnahmeverbot der Schuldenbremse.
Das 3,5-Prozent-Ziel will die Regierung Merz/Klingbeil bereits im Jahr 2029 erreichen. Geplant sind laut der aktuellen Finanzplanung des Bundes drastische Steigerungen im Rüstungsetat, und dies auch nach dem Auslaufen des noch unter Bundeskanzler Scholz beschlossenen 100 Milliarden Euro schweren Sondervermögens Bundeswehr. Auf mehr als 150 Milliarden Euro sollen sich die Militärausgaben bis zum Jahr 2029 erhöhen. Damit würden sie sich ausgehend vom Jahr 2023 innerhalb von sieben Jahren verdreifachen.
Die Politökonomen Tom Krebs und Patrick Kaczmarczyk von der Universität Mannheim kommen nach einer Auswertung von einschlägigen Untersuchungen zur Wirkung von Rüstungsausgaben allerdings zu einem ernüchternden Ergebnis. Ein Euro an Militärausgaben schafft nach ihrer Einschätzung eine zusätzliche Produktion von 0 bis höchstens 50 Cent. Grund dafür sei die hohe Auslastung der Rüstungsindustrie und der geringe Wettbewerb aufgrund intransparenter Vergabepraktiken. Zwar könne es, etwa durch Kapazitätserweiterungen, zu einem höheren Effekt kommen – das aber brauche Zeit. In den nächsten Jahren würden zusätzliche Militärausgaben vor allem die Preise und damit die Profite im Rüstungssektor in die Höhe treiben. Ganz unabhängig davon dürfte ein nicht unerheblicher Teil der vermeintlich benötigten Rüstungsgüter aus dem Ausland bezogen werden – diese Ausgaben hätten im Inland einen dauerhaften Beschäftigungseffekt von null.
Vergeudung von Ressourcen
Werden im Laufe der Zeit die Produktionskapazitäten im Rüstungsbereich ausgebaut und so immer mehr reale Ressourcen und Personal im Rüstungsbereich eingesetzt, dann fehlen diese an anderer Stelle. Die Rüstungs-Milliarden könnten sinnvoller eingesetzt werden, etwa für die Energiewende oder im Bereich der Bildungsinfrastruktur. So würden allein die für 2029 veranschlagten deutschen Rüstungsausgaben in Höhe 153 Milliarden Euro ausreichen, um den gesamten Investitionsstau in Kitas (11 Milliarden Euro), Schulen (68 Milliarden Euro) und Hochschulen (74 Milliarden Euro) zu beseitigen. Und der gesamte Investitionstau der Kommunen in Höhe von aktuell 216 Milliarden Euro, der den Investitionsstau der Kitas und der Schulen umfasst, könnte durch die Rüstungsetats der Jahre 2027 und 2028 problemlos beseitigt werden.
Begründet wird der Anstieg der Militärausgaben bekanntlich mit der von Russland ausgehenden Gefahr eines Angriffs auf ein europäisches Nato-Land. Warum die bereits jetzt verausgabten Mittel der europäischen Nato-Länder zur Abschreckung nicht ausreichen, kann rational nicht begründet werden. Laut den aktuellen Daten des Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) geben allein die sieben europäischen Nato-Länder Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Polen und Spanien das 2,4fache der geschätzten Militärausgaben Russlands aus.
Zinslast für künftige Generationen
Für eine Kreditfinanzierung öffentlicher Investitionen gibt es gute Argumente. Öffentliche Investitionen erhöhen den Bestand der staatlichen Infrastruktur in Form von Schulen, Kitas, Verkehrswege usw. Sie schaffen so die Voraussetzungen für zukünftiges Wachstum, was auch kommenden Generationen zugutekommt. Durch ein auf diesem Wege erzieltes höheres BIP wird auch die Schuldenlast tragbar: Zins- und gegebenenfalls Tilgungszahlungen sind durch ein entsprechendes Plus bei den Steuereinnahmen kein Problem. Auch Rüstungsgüter zählen zu den staatlichen Investitionen – für sie gilt der gerade dargelegte Zusammenhang allerdings nicht.
Der Grund dafür ist die destruktive Rolle von Rüstungsgütern. Ihre Produktion stellt anders als etwa Schulen oder Hochschulen keine Voraussetzung für die gesellschaftliche Produktion dar. Ganz im Gegenteil: Im besten Fall werden Waffen gar nicht eingesetzt, dann aber hat ihre Produktion keinen wirtschaftlichen Nutzen. So bleibt bei einer kreditfinanzierten Beschaffung von Rüstungsgütern ein Anstieg der Staatsverschuldung, der in der langen Frist keine positive Wirkung auf das gesamtwirtschaftliche Produktionspotenzial hat. Dadurch wird das Plus bei der Staatsverschuldung zu einer Belastung für zukünftige Haushalte. Aufgrund einer steigenden Zinslast werden andere Ausgaben in den Bereichen Bildung, Soziales usw. unter erheblichen Druck geraten.
Schlussfolgerung
Die von der Bundesregierung geplante exorbitante Erhöhung der Militärausgaben ist unter ökonomischen Gesichtspunkten problematisch. Sie droht eine Rüstungsspirale anzuwerfen, die zu einer gigantischen Verschwendung von Ressourcen führt. Der steigenden Staatsverschuldung werden keine ökonomisch produktiven staatlichen Infrastrukturgüter gegenüberstehen. Die steigende Zinsbelastung der öffentlichen Haushalte wird so zu Einschnitten in gesellschaftlich wichtigen Bereichen wie Bildung und Soziales führen – Bereiche, die sowieso schon unterfinanziert sind.
Angesichts der bereits jetzt bestehenden Höhe der Rüstungsausgaben der europäischen Nato-Länder ist der Aufrüstungskurs der Bundesregierung und der Nato nicht zu rechtfertigen. Statt nach dem Motto „Whatever it takes“ (Friedrich Merz) die Rüstungsspirale immer schneller und weiterzudrehen, sollten diplomatische Initiativen ergriffen und unterstützt werden, um diese Entwicklung zu stoppen.

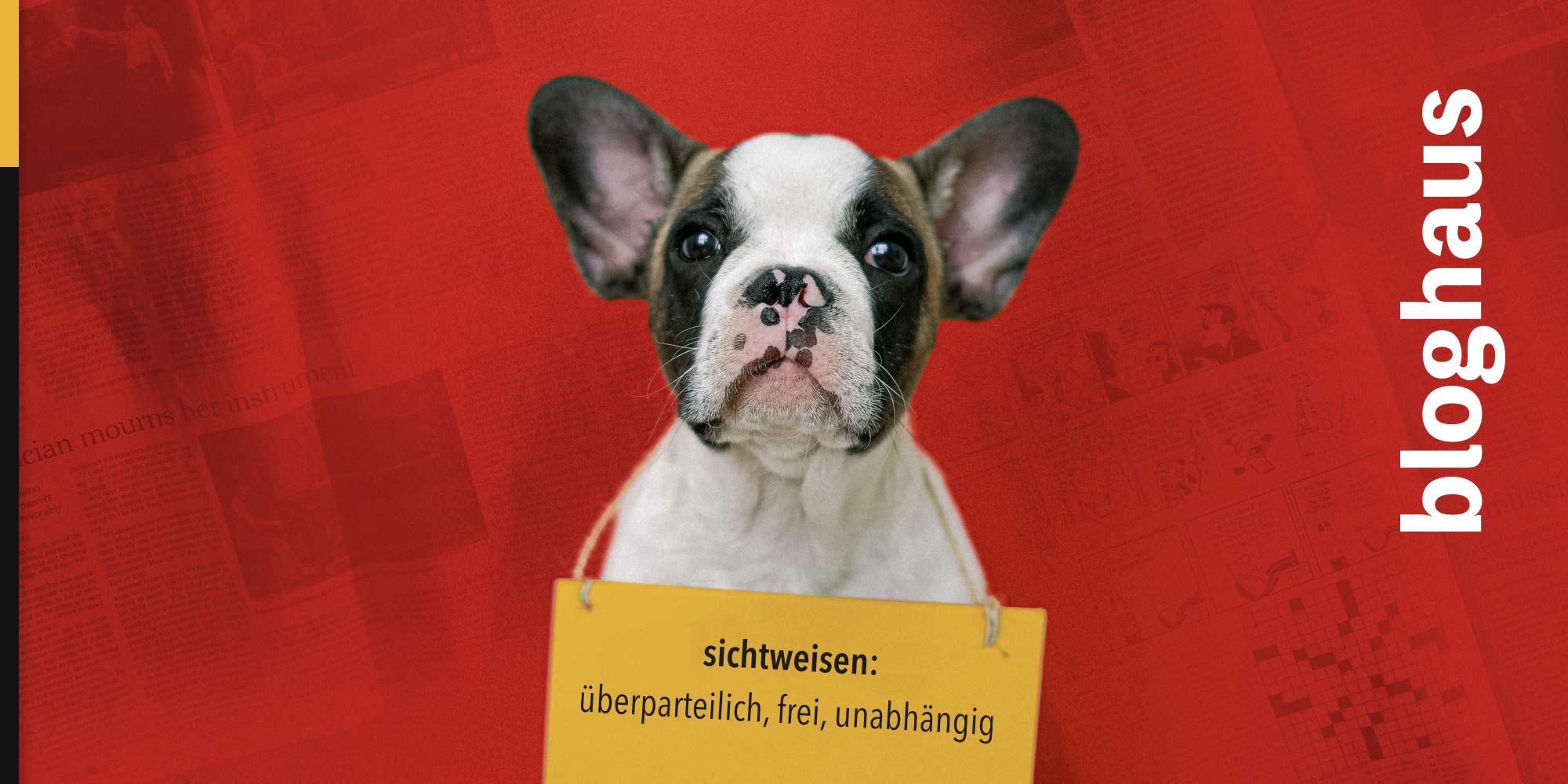




In diesem Artikel fehlt mir aber noch der von gewissen Kreisen gerne genutzte Spruch, dass von Russland keinerlei Gefahr für Deutschland ausgehe.
Vielleicht habe ich ihn auch nur überlesen.
Es gibt viele „Russlandversteher“, auch leider viele davon, die nichts von Russland verstehen.